Die neuen Realien der Informationsgesellschaft, wozu die neuen Verbindungsmittel sowie die neuen Informationsträger (die heute existierenden und die künftigen) gehören, und die breite Entwicklung der Informationsnetze schaffen neue Bedingungen für die Tätigkeit der Bibliotheken, bedingen die Notwendigkeit bestimmter Innovationen und erfordern einen neuen Blick auf die grundlegenden Kriterien der Planung von Bibliotheksgebäuden. Aus diesem Zusammenhang ist zu schlußfolgern, dass in allen vorangegangenen Perioden die Übertragung von jeder beliebigen Information in Bibliotheken vor allem untrennbar verknüpft war mit ihrem physischen Träger; jedoch die gegenwärtige und um so mehr die künftige Informationstechnologie erlaubt es zunehmend, die Untrennbarkeit dieser Verbindung auszuschließen oder sie auf ein Minimum zu reduzieren.
Weil die Einrichtung kurzer Bewegungsräume für Leser und Mitarbeiter sowie kürzeste Wege für den Transport von Büchern und für die Realisierung der Anforderungen der Leser hinsichtlich der Literaturbeschaffung stets grundlegende Prinzipien bei der Planung von Bibliotheksgebäuden und insbesondere für die Anordnung der Buchbestände, der Lesesäle und Kataloge waren, wollen wir uns ausführlicher mit diesem Problem hinsichtlich seiner Aktualität bei der gegenwärtigen und perspektivischen organisatorischen Arbeit großer Bibliotheken beschäftigen.
Eine solche Analyse ist auch deshalb nützlich, weil die genannten Bibliothekskriterien in Verbindung mit den ökonomischen (Verringerung der Bebauungsflächen und entsprechender Kostensenkung für die Bodenparzellen, der Verkleinerung des umbauten Raumes, der notwendigen klimatischen Anforderungen sowie der Schalldämmung etc.) auch Auswirkungen hatten auf die architektonische Maxime bzw. das Prinzip der Kompaktheit des Bibliotheksgebäudes. Allerdings führte die Realisierung dieses Prinzips bei der Gebäudeplanung neben positiven Auswirkungen auch zu bestimmten Mängeln, weil Schwierigkeiten auftraten. So wurde häufig wegen der mangelnden Flexibilität eine spätere Veränderung der Flächen jeder Bibliothekszone im Zusammenhang mit der Entwicklung der Bibliothek insgesamt völlig unmöglich gemacht.
Dies lässt sich damit erklären, dass sich die Notwendigkeit ergab, sorgfältig neue Prinzipien der funktionalen Organisation von Bibliotheksgebäuden zu erarbeiten; dazu gehört das Prinzip der unabhängigen räumlichen Entwicklung jeder Zone des Bibliotheksgebäudes: Lesezone, Magazine und interne Arbeitszone mit der Möglichkeit ihrer modulmäßigen Veränderbarkeit in Abhängigkeit von den sich ändernden Arbeitsbedingungen der Bibliothek, ihrer Stellung auf dem Informations-Dienstleistungsmarkt und ihrer sozio-kulturellen Funktion in der Gesellschaft. Es ist praktisch unmöglich, eine Entwicklung der Bibliothek zu prognostizieren wie beispielsweise die Zusammensetzung der Bestände, der Leser etc. Versuchen wir folglich, die Dynamik der Entwicklung der inneren Planung der Lesezone des Bibliotheksgebäudes einzuschätzen.
2. Rolle und Entwicklungstendenzen der Wissenschaft bei der Planung der Lesezone
Während es seit der zweiten Hälfte des 19. sowie in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts als ein grundlegendes Prinzip galt, die Hauptlesesäle der Bibliotheken gesondert einzurichten und die Aufteilung der Säle nach den Prioritäten hinsichtlich der Bedienung verschiedener Kategorien von Lesern zu setzen, ergab sich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts die Grundtendenz, die Lesesäle aufzuteilen nach dem Prinzip des jeweiligen Zweiges der zu benutzenden Literatur. Dieses Herangehen ist in hohem Maße zurückzuführen auf die schnellen Prozesse der Differenzierung der wissenschaftlichen Kenntnisse und verbessert die Möglichkeit, die spezielle Fachliteratur dem Leser nahezubringen, das heißt es entsteht eine deutliche Abtrennung bzw. Absonderung der Lesesäle, der Nebenbestände, und in einer Reihe von Fällen werden auch bestimmte Teile von Basisbeständen nach dem Zweigprinzip angeordnet.
In der letzten Zeit allerdings sind die großen akademischen Bibliotheken immer stärker in Berührung gekommen mit Informationserfordernissen aus unterschiedlichen bzw. gemischten Zweigen sowie mit der Intensivierung der Integrationsprozesse in der Wissenschaft, was sich auch ausdrückt in der wissenschaftlichen Literatur. Dies erklärt auch die Tendenz zum Übergang von Lesesälen auf Zweigbasis zur Einrichtung von vergrößerten universellen Dienstleistungszonen für die Leser und der Abtrennung einzelner Gruppen von Regalen mit Fachliteratur für die Freihandausleihe innerhalb des Bereiches der allgemeinen Lesezonen in großen wissenschaftlichen Bibliotheken. Natürlich hat die Schaffung allgemeiner Lesezonen auch Einfluß auf die Bildung von Leserströmen und ihre Konzentration in der Bibliothek, dies hat Auswirkungen auf die Planung des gesamten Lesebereiches etc. Doch dabei muß man unbedingt auch noch etwas anderes beachten.
3. Die Entwicklung des Prinzips der Bibiotheksfunktionalität bei der
inneren Planung der Lesezone
Der Übergang von der Planung zentraler Hauptlesesäle zu deutlich aufgeteilten Fachlesesälen verkörperte, was die architektonisch-planerischen Probleme angeht, in der Tat den Übergang bezüglich der bibliothekarischen Dienstleistungen vom Prioritätsprinzip zum Zweig- oder Fachprinzip, das nicht mehr gebunden war an soziale, bildungsmäßige oder andere Besonderheiten unterschiedlicher Leserkategorien (z.B. Professoren, Lehrer, Studenten in akademischen Bibliotheken oder Bibliotheken in Lehranstalten). Gleichzeitig begünstigte diese Entwicklung das Prinzip der Funktionalität hinsichtlich der inneren Planung, was gegebenenfalls formuliert werden kann als die Unterordnung der bibliothekarischen Dienstleistungen unter dieses Prinzip, inklusive die Bereitstellung geeigneter Operationen der Literaturrecherche für den Leser, die Auslieferung oder Rückgabe der Literatur, aber auch die Bereitstellung von Platz für das Studium der Literatur in jedem beliebigen Fachlesesaal. Eine wichtige Rolle innerhalb dieser Entwicklung spielte auch die Ökonomie der materiellen Ressourcen, die unabdingbar sind für den Bau von Bibliotheksgebäuden sowie für die Einrichtung von Lesezonen nach dem Fachprinzip bei geringer Höhe der Stockwerke, in denen sich die Lesezonen befinden.
Daraus ergibt sich die Frage, ob man unter den bibliothekarischen Funktionen nur technologische Prozesse und Operationen zu verstehen hat, die unmittelbar auf die Bedienung der Leser fokussiert sind, oder ob zu den Funktionen einer Bibliothek ein breiteres Spektrum von Aufgaben gehört, einschließlich der Schaffung einer psychologischen Einstimmung auf den Besuch der Bibliothek, der Arbeit in ihr, des Bewußtwerdens der eigenen Anteilnahme an der Welt des Gebäudes und der Einschätzung der Bibliothek als eines Tempels der Wissenschaft. Innerhalb des breiten Spektrums der Meinungen über die Rolle z.B. der Universitätsbibliotheken innerhalb der Gesamtstruktur des Bildungs- und Erziehungsprozesses sowie innerhalb der wissenschaftlichen Tätigkeit in der Universität gibt es diametral entgegengesetzte Positionen. Die eine Position vertritt die Ansicht, dass die Bibliothek noch stärker als eine Art Zentrum für Begegnungen, Gespräche und Diskussionen (7) in den Universitätscampus integriert wird, die andere plädiert dafür, dass die Bibliothek in erster Linie die Begegnung mit dem Buch fördern solle, für die zielgerichtete Arbeit da sei mit dem Ziel des Wissenserwerbs und kein Klub sei für irgendwelche Begegnungen mit den entsprechenden inneren Gestaltungen der Lesezonen.

Geht man davon aus, dass die Wahrheit in der Regel in der Mitte liegt, dann sehen wir die Aufgabe der Bibliotheken darin, dass sie das gesamte Spektrum der Interessen der Leser abdeckt. Bei der Verwirklichung dieser so weit gefaßten Rolle der Bibliotheken spielt der gesamte Raum der Lesezonen eine große Rolle, desgleichen die Höhe der Einrichtungen für den Leser, ihre Sättigung mit Frischluft und Licht. In diesem Sinne sind die besten Bibliotheksgebäude zu Prototypen der Weltarchitektur geworden: die Bibliothek des Britischen Museums in London, die Bibliothèque Nationale in Paris, die Kongreßbibliothek in Washington (s. Beitrag von Wüst in diesem Heft), die ehemalige Königliche Bibliothek in Berlin (der Hauptlesesaal wurde während des Zweiten Weltkrieges zerstört) und viele andere.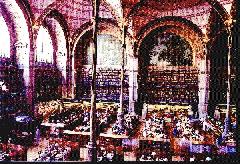 Natürlich kann man nicht zu den historischen Stilen der Vergangenheit zurückkehren bzw. sich diese Aufgabe ernsthaft stellen. Die gegenwärtige architektonische Konzeption der Einrichtung einer Lesezone in Bibliotheksgebäuden hat eine rationale Grundlage - die soziale Gleichstellung der angebotenen bibliothekarischen Dienstleistungen und die funktionale Zusammenführung der inneren Planung mit den zu bewältigenden bibliothekarischen Prozessen. Man könnte viele Beispiele hervorragender Bibliotheksgebäude anführen, in denen gerade diese Prinzipien der Bibliotheksarchitektur zur Anwendung kamen.
Natürlich kann man nicht zu den historischen Stilen der Vergangenheit zurückkehren bzw. sich diese Aufgabe ernsthaft stellen. Die gegenwärtige architektonische Konzeption der Einrichtung einer Lesezone in Bibliotheksgebäuden hat eine rationale Grundlage - die soziale Gleichstellung der angebotenen bibliothekarischen Dienstleistungen und die funktionale Zusammenführung der inneren Planung mit den zu bewältigenden bibliothekarischen Prozessen. Man könnte viele Beispiele hervorragender Bibliotheksgebäude anführen, in denen gerade diese Prinzipien der Bibliotheksarchitektur zur Anwendung kamen.
4. Die räumliche Organisation der Lesezone als Faktor ihrer Bibliotheksfunktionalität
Gegenwärtig bleibt die Aufgabe aktuell, die bestmögliche räumliche Aufteilung der Lesezone zu erkunden, sowohl aus dem Blickwinkel der laufenden Aufgaben der Bibliotheksdienstleistungen, des zahlenmäßigen Anwachsens der Leserschaft, der Veränderung des Charakters ihrer Ansprüche unter den Bedingungen der Informationsgesellschaft als auch aus dem Blickwinkel der weiteren Entwicklung der bibliothekarischen Dienstleistungen als organischer Bestandteil eines einheitlich strukturierten Informationsmarktes und der Informationsdienstleistungen. Es kann auch mit Bedauern festgestellt werden, dass die Verbreiterung der technischen Möglichkeiten des Bauens, einschließlich der Möglichkeiten der Skelettbauweise, der Möglichkeit der Schaffung von Stockwerken mit einer großen Fläche, der Schaffung von Voraussetzungen für die Entwicklung unterschiedlichster architektonischer Formen in Übereinstimmung mit explizit ausgedrücktem und oft vulgarisiert verstandenem Streben nach ökonomischer Rationalität, nicht selten zur Projektierung von Bibliotheksgebäuden führt, die hinsichtlich Monotonie und trostloser Eintönigkeit zur "modularen Kastenarchitektur" gerechnet werden muß (4).

Man muß in diesem Zusammenhang auch anmerken, dass der Architekt Hans Scharoun in der Berliner Staatsbibliothek kraft seines Talentes zwei Grundsätze zu vereinen vermochte: eine große Höhe der Lesezone (bis zu zehn Meter) mit einer breiten Möglichkeit der Flexibilität ihrer Planung und einer ausgezeichneten Nutzung des gesamten Umfanges des Arbeitsraumes mittels Galerien, die sich über mehrere Etagen erstrecken. Wichtig ist auch, dass er jedwede visuelle Wiederholung einzelner Teile der Lesezone vermied und dadurch auch keine Monotonie von ihr ausging. Dennoch gewährleistete er jedem Leser die Möglichkeit, seinen Arbeitsplatz frei zu wählen in einem beliebigen Teil des Lesesaales: vom sehr lebhaften und hochkonzentriert genutzten Teil bis zu wenig genutzten, fast einsamen Teilen. Die Möglichkeit einer solchen Auswahl in Verbindung mit unterschiedlichen Höhen des Gebäudes kommt der gesamten vielfältigen psychologischen Verfassung der Leser entgegen, ihrer Arbeitserfahrung mit Büchern und anderen individuellen Besonderheiten, die ihnen eigen sind. Was die Frage der ökonomischen Effektivität betrifft, mit der man bisweilen die Verminderung der Höhe des Gebäudes und die Projektierung einer rechteckigen Form der Lesezone begründet bei gleichzeitiger Erhöhung der Anzahl der Stockwerke, so zeigen die einfachen Berechnungen deutlich, dass es im Grunde keinerlei wesentliche Einsparung von Mitteln dabei gibt.
5. Gemeinsame Projektarbeit zwischen Architekten und Bibliothkaren - Wer vertritt den Leser?
Die Aufgabe der bestmöglichen Planung der Lesezone wie auch die des gesamten Bibliotheksgebäudes wird im übrigen betrachtet als ein Gegenstand gemeinsamer Arbeit von Architekten und Bibliothekaren. In den unterschiedlichen historischen Perioden war diese Gemeinschaftsarbeit bei der Planung von Bibliotheksgebäuden in unterschiedlichem Maße effektiv. Die Suche optimaler Formen der Zusammenarbeit von Architekten und Bibliothekaren ist hinreichend ausführlich in der bibliothekarischen Fachpresse erörtert worden. (1; 4,S.130). Den Diskussionen liegt stets die Auffassung zugrunde, dass der Architekt in sich das architektonische Wissen konzentriert, der Bibliothekar das konzentrierte bibliothekswissenschaftliche Wissen einbringt.
Hier muß allerdings darauf hingewiesen werden, dass bisher bei diesen Diskussionen immer der Leser als eine aktiv handelnde Person während des Planungsprozesses fehlte. Man ist immer davon ausgegangen, dass der Bibliothekar gemeinsam mit dem Architekten einen funktionalen bibliothekarischen Grundsatz verkörpert und automatisch die Interessen der Leser vertritt. Diese Auffassung ist leider nicht immer richtig. Sie hat ihren Ursprung in der Meinung, dass die Funktionalität der Bibliothek nur als die Gesamtheit der technologischen Dienstleistungsprozesse zu begreifen ist. Nach unserer Auffassung sollte ein Psychologe, der die entsprechenden professionellen Forschungsmethoden beherrscht, die Interessen des Lesers vertreten.
6. Die Rolle der Psychologie bei der architektonischen Projektierung
Die Bedeutung der Rolle der Psychologie bei der architektonischen Planung führte schon vor einigen Jahrzehnten zu einer neuen wissenschaftlichen Disziplin - der Architekturpsychologie. Ihr Entstehen als ein Zweig der angewandten Psychologie ist verbunden mit dem Jahre 1969, als im Rahmen eines Kongresses an der Strathclyde University in Schottland sich Architekten und Psychologen trafen, um die Erfahrungen gemeinsamer Arbeit zu erörtern.(2; 6, S.70-71). Im Interesse des Wohnungsbaus, Städtebaus, des Baus von Krankenhäusern, Schulen und Gebäuden mit gesellschaftlicher Relevanz wurden in den vergangenen 30 Jahren viele angewandte Forschungen auf dem Gebiet der Architekturpsychologie durchgeführt.
Zu den umfassenden Aufgaben der Architekturpsychologie gehört es zu erforschen, wie der Mensch künstliche, mit architektonischen Mitteln geschaffene Umweltverhältnisse sowie die materiellen Mittel des Wohnens wahrnimmt und verarbeitet, aber auch Hilfe zu leisten bei ihrer Verbesserung und, wenn möglich, bei deren Optimierung im Interesse des Menschen oder von Menschengruppen. Es gibt die Auffassung, dass neben den eigentlichen materiellen Mitteln die Architekturpsycholgie ebenfalls alle vielfältigen und spezifischen sozialen und institutionellen Bedingungen des Menschen oder von Menschengruppen sowie ihre Wechselwirkung mit den materiellen Mitteln des Wohnens erforschen muß. (5; 8). Zu den grundlegenden Fragen, auf die der Psychologe Antworten sucht, gehören die folgenden: Wie können die jeweiligen konkreten Mittel des Wohnens Einfluß nehmen auf die psychologische Verfassung des Menschen? Mit Hilfe welcher Indikatoren kann man die Mittel des Wohnens beeinflussen? Wie sind diese Indikatoren untereinander verbunden? u.a.
Es erweist sich auch als eine wichtige Frage, ob die Methoden, die den Zusammenhang zwischen Mensch und architektonischen Wohnmöglichkeiten erforschen sowie die Empfehlungen der Psychologen zu dieser Problematik, universellen Charakter bezüglich aller architektonischen Objekte und der entsprechenden sozialen Rollen und Verhaltenssituationen des Menschen haben; wie sie in der einen oder anderen Weise realisiert werden (zu Hause, im Theater, auf der Arbeit, in der Bibliothek, im Hörsaal, Krankenhaus etc.). Wenn sie universellen Charakter haben, welche Beziehung gibt es dann allgemeiner Art für alle Objekte und welche Teilprobleme ergeben sich aus jeder einzelnen ihrer Methoden und Empfehlungen?
Wenn man von der Hypothese ausgeht, dass die Erstellung allgemeiner Empfehlungen möglich ist, wie hoch muß dann das Niveau der Verallgemeinerung für einen adäquaten Übergang vom Einzelfall zur Gesamtproblematik und umgekehrt sein? Ihrem Wesen nach stellt sich die Aufgabe analog der Problematik einer Verbindung zwischen allgemeiner und angewandter Psychologie, allerdings mit dem wesentlichen Unterschied, dass die Verbindungen zwischen den Ebenen in den angewandten wissenschaftlichen Disziplinen immer weniger zuverlässig und explizit ausgedrückt sind als ihre Verbindungen zum wissenschaftlichen Basiszweig, da sie stärker dem Einfluß des Forschungsobjektes unterworfen sind. Dieser Einfluß kann derart groß sein, dass er zu einem Minimum führt, auch oder sogar dann, wenn diese Verbindungen zwischen den Ebenen theoretisch existieren.
Wenn man annimmt, dass unterschiedliche Disziplinen der angewandten Psychologie - in unserem Falle die Architekturpsychologie - verwandte, aber auch unabhängige Wissensgebiete darstellen, dann erwächst in diesem Falle die Aufgabe der Schaffung eines Klassifikationsmerkmals, was unabdingbar und notwendig ist für den Aufbau einer Klassifikationsreihe solcher angewandter wissenschaftlicher Disziplinen. Nach unserer Auffassung ist ein grundlegendes Klassifikationsmerkmal bei der Strukturierung einer Reihe wissenschaftlicher Disziplinen innerhalb der Architekturpsychologie der Anblick des architektonischen Objektes, weil gerade er auch die soziale Rolle des in ihm und mit ihm handelnden Menschen bestimmt (Leser, Zuschauer, Lernender, Bewohner einer Wohnung etc.) und das dazugehörige Stereotyp seines Verhaltens. Natürlich erfordert die Gesetzmäßigkeit des Baus einer solchen Reihe eine besondere Forschungsarbeit, doch sie ist zielgerichtet auf die praktische Nutzung und schließt nicht die Möglichkeit der Formierung anderer Klassifikationsreihen, in Abhängigkeit von der angesammelten Erfahrung, aus.
7. Die Bibliotheks-Architekturpsychologie. Objekt und Gegenstand
Die Annahme eines objektiven Merkmals in Gestalt der Klassifikationsgrundlage ermöglicht es, wissenschaftliche und entsprechende Lehrdisziplinen zu benennen und zu definieren, und zwar für die Bibliotheksfakultäten und die Bereiche, die für die Weiterbildung zuständig sind: Bibliotheks - Architekturpsychologie oder Biblioarchitekturpsychologie.

Das Objekt der Biblioarchitektur-
psychologie ist das Zusammenwirken des Menschen und der ihn umgebenden bibliotheks-
architektonischen Mittel. Praktische Anwendung fand dieses Prinzip bereits vor Jahrzehnten in der amerikanischen Bibliotheksarchitektur, wo schon frühzeitig das Wohlbefinden der Leser ein wesentlicher Gesichtspunkt der Planung war.
Der Gegenstand der Biblioarchitekturpsychologie ist die Erforschung der Wechselwirkung zwischen dem Menschen und den ihn umgebenden bibliothekarisch-architektonischen Mitteln sowie die Erarbeitung von Empfehlungen an Architekten und Bibliothekare hinsichtlich der Projektierung eines äußeren Erscheinungsbildes und der Gestaltung der inneren Räumlichkeiten des Bibliotheksgebäudes. Dazu gehört des weiteren die Planung und technische Ausstattung mit dem Ziel, diese mit den Bedürfnissen der Leser und Mitarbeiter in Übereinstimmung zu bringen. Letztendlich muß auch beachtet werden, dass diese Bedürfnisse sich in Übereinstimmung mit dem sozio-kulturellen, ökonomischen und wissenschaftlich-technischen Entwicklungsniveau der Gesellschaft befinden.
8. Bibliotheken in der Informationsgesellschaft und die Biblioarchitekturpsychologie
Die Herausbildung jeder beliebigen angewandten wissenschaftlichen Disziplin bedingt ein gesellschaftliches Bedürfnis zu ihr. Worin besteht nun das gesellschaftliche Bedürfnis nach einer Biblioarchitekturpsychologie?
Wir glauben, dass es dafür mehrere Gründe gibt. Die wichtigsten von ihnen sind die folgenden:
8.1 Zur Position des Lesers
- Das Aufkommen und die schnelle Entwicklung von Computernetzen und der Computerisierung der bibliothekarischen Prozesse insgesamt haben eine Umwandlung der Lesezone und ihrer Verbindung mit den Magazinen und der internen Arbeitszone zur Folge. Weil dieser Vorgang ohne Unterbrechung verläuft und eine immer größere Dynamik entwickelt, ist eines seiner wichtigsten Ergebnisse die schnelle Veränderung der Zentren der Leserkonzentration, ihrer Bewegungsrichtungen und ihrer Verteilung in der Lesezone.
- Die Benutzung von eigenen und bibliothekseigenen Computern durch die Leser nimmt zu. Die Zettelkataloge werden immer mehr an die Peripherie der Lesezone verdrängt und verlieren immer mehr an Bedeutung. Es verändern sich die Motivation und die Prioritäten der Leser bei den von ihnen gewählten Algorithmen hinsichtlich der Benutzung der Lesezone.
- Die Benutzung computerisierter Kataloge erlangt den Charakter von bibliographischen Dienstleistungen in der Lesezone. Gleichzeitig wandeln die computerisierten Kataloge immer stärker die bibliographische Dienstleistung in Selbstbedienung um. Damit wird die Computerkompetenz der Leser zu einem immer wichtigeren Faktor.
- Die Entwicklung des Informationsmarktes und der Informationsdienstleistungen, die wachsende Konkurrenz und die immer stärkere Einbindung der Bibliotheken in diesen Markt erzwingen eine Verbesserung der Dienstleistungen für den Leser, d.h. die Umwandlung der bibliothekarischen Dienstleistungen in einen Bibliotheksservice. Die Lösung dieser Aufgabe wird immer wichtiger, gleichzeitig aber auch komplizierter angesichts der schwierigen Situation der Bibliotheken aufgrund der begrenzten finanziellen Mittel.
- Die praktisch nicht vorhersehbare Entwicklungstendenz der Bibliotheken, ihre Stellung innerhalb der Informationsgesellschaft unter den Bedingungen der stürmischen Veränderung der Informationsverbindungsstrukturen, der Rolle der Multimedia und der sozio-kulturellen Situation erfordern eine Umwandlung der Lesezone, ihrer Projektierung, eine neue und sich schnell verändernde technische Ausstattung derselben, höhere Anforderungen an die Akustik, eine Neuausstattung der Arbeitsplätze, unter anderem ihre Verteilung in der Lesezone sowie die Einrichtung eigenständiger Arbeitsplätze, ihre schrittweise Umwandlung in eine Art geschäftlichen Dienstleistungsplatz mit Computer, Scanner, einer Verbindung zum Internet, einem geräuschlosen Faxgerät etc. Es ist auch nicht auszuschließen, dass die Bibliotheken in Zukunft damit beginnen, einen Teil dieser Arbeitsplätze an kleinere Firmen und Geschäftsleute zu vermieten unter den Bedingungen ihrer vollständigen technischen Auslastung und für die Unterweisung hinsichtlich ihrer Benutzung. Das Interesse an solchen Arbeitsplätzen und an dem entsprechenden Informationsservice kann sich als sehr groß erweisen im Zusammenhang mit der Schaffung einer neuen Qualität des Bibliotheksservices.
- Viele Bibliotheksnutzer nutzen diese Einrichtung für die eigene Weiterbildung und können dort Anregungen erhalten für die Intensivierung des Weiterbildungsprozesses. Wenn die Bibliotheken mit ihrer inneren Umgestaltung, der technischen Umrüstung und hinsichtlich der Möglichkeiten der Literaturrecherchen die Wünsche der Nutzer erfüllen oder sie gar übertreffen, dann ergibt sich aus den Erfahrungen der Vergangenheit, dass sie vom Leser noch eifriger genutzt werden und dass er sie einer weniger servicefreundlichen Einrichtung vorziehen wird.
- Bei einer entsprechenden inneren Gestaltung der Lesezone kann die Bibliothek den Nutzern eine freie Auswahl des Arbeitsplatzes bieten, von intensiver besuchten Teilen der Lesezone bis hin zu abgeschiedenen, was den Gewohnheiten und Wünschen unterschiedllicher Lesertypen entgegenkommt bzw. unterschiedliche Verfassungen des einen oder anderen Lesers berücksichtigt. Wie sollte das Verhältnis von stillen zu "lauten" Teilen der Bibliothek sein? Auf den ersten Blick wäre die Einrichtung nur abgeschiedener Leseplätze die ideale Gestaltungsentscheidung, weil die Leser sich ohne Störungen in die Lektüre vertiefen wollen. Jedoch, als der Architekt Kahn bei der Projektierung der Universitätsbibliothek in Exeter (New Hampshire) in der Lesezone Nischen für die individuelle Nutzung und Vertiefung der Lektüre vorsah, verstanden die Studenten diese als Refugien für weniger anstrengende Tätigkeiten und lehnten sie also in ihrer ursprünglichen Intention ab. Sie begreifen die Bibliothek als einen Ort der Kommunikation, als einen Ort der Begegnung. (7). Darüber kann man geteilter Meinung sein, doch eine solche Einstellung der Nutzer darf auch nicht ignoriert werden.
- Die Bibliothek muß dem Leser die Möglichkeit einer möglichst einfachen Literatursuche gewährleisten und, was sehr wichtig ist, einen einfachen Übergang von der Literatursuche in den Beständen mit offenem Zugang zur Suche in den Katalogen ermöglichen. Wenn man erlebt, dass man für die Literatursuche sehr viel Zeit braucht, kann die Sorge über Vielfältigkeit der Algorithmen der Suche dazu beitragen, dem Leser der Literatur die Bibliothek attraktiver werden zu lassen.
- Eine der Besonderheiten der Bibliotheken besteht darin, dass es verschiedene Ebenen und Motivationen für ihre Nutzung gibt: von der strengen Notwendigkeit bezüglich der Literatur bis hin zur Befriedigung, die ein Bibliotheksbesuch gewährt oder bis zum Lesen von neuesten Zeitschriften bis zur Aufnahme von Verbindungen.
- Ein langer Aufenthalt in der Bibliothek erfordert Veränderungen hinsichtlich Umgebung und Bewegung. Unterschiedliche Leser sind diesem Bedürfnis in unterschiedlichem Maße unterworfen, was ihnen bewußt ist oder im Unterbewußtsein vorhanden ist.
- Es ist bekannt, dass bei der räumlichen Gestaltung der Lesezone der freie Zugang eine sehr wichtige Rolle spielt. In den Bibliotheken der Bundesrepublik Deutschland, die zwischen 1968 und 1983 gebaut worden sind, waren beispielsweise 53% des Gesamtbestandes der Bibliotheken im freien Zugang (3.). Die Entwicklung des freien Zugangs wird nur beherrscht und gezügelt durch die Größe der notwendigen Fläche.
- Die Fragen des offenen Zuganges, der Wechselwirkung zwischen Nutzern und Bibliothekaren bei den Regalen des freien Zugangs, die Aufstellung von Regalen im Raum der Lesezone sind eine wichtiges Element bei der Verbesserung der Beziehungen zwischen Leser und Bibliothek. Die existierenden Alternativen bei der Organisierung des offenen Zuganges und seines Anteils am Gesamtbestand erfordern psychologische Forschung und entsprechende Begründungen.
Es ist selbstverständlich, dass die Erforschung der aufgeführten, aber auch der vielen anderen Fragen eine professionelle psychologische Vorbereitung erfordern sowie die Durchführung psychologischer Tests, die Schaffung von Expertengruppen unter Beteiligung von Architekten, Bibliothekaren und Psychologen, aber auch die aktive Zusammenarbeit mit den Nutzern etc.
Es ist offensichtlich schwierig, eine Bibliothek zu projektieren, die sich das Ziel stellt, die ganze Vielfalt der Leserwünsche und individuellen Besonderheiten zu berücksichtigen, gleichzeitig ist es aber völlig unzulässig, das Bibliotheksgebäude auf den "durchschnittlichen" Leser auszurichten, weil es den nicht gibt. Die Frage der Anpassung des Gebäudes an die individuellen Erfordernisse und Neigungen ist eine Problematik ihrer richtigen psychologischen Einschätzung und einer talentierten architektonischen Realisierung.
8.2 Zur Position des Bibliothekars
Es ist ganz natürlich, dass man sich bei der Planung einer Bibliothek und ihrer Lesezone unbedingt in erster Linie um die Interessen des Lesers kümmert. Gleichzeitig wäre es unzulässig, die Interessen des Bibliothekars nicht zu berücksichtigen, den Einfluß der architektonischen Mittel auf seine Arbeitsfähigkeit, seine Motivation, seine gesamte psychologische Verfassung etc. Es wäre falsch anzunehmen, dass die Schaffung einer günstigen Innenarchitektur der Lesezone im Interesse des Lesers in jedem Falle auch angenehme Bedingungen für den Bibliothekar gewährleisten. Hierbei sollte man auch bedenken, dass der Bibliothekar den ganzen Tag auf seinem Arbeitsplatz ausharren muß und dass der Umgang mit einem großen Teil der Leser nicht nur positive Emotionen auslöst. Zu ergänzen ist in diesem Zusammenhang noch, dass der Leser die Bibliothek nach dem Bibliothekar beurteilt. Damit wird dem Bibliothekar eine große Verantwortung auferlegt, und die Sorge um sein angenehmes Arbeitsklima ist nicht nur eine rein humanitäre Frage, sondern auch eine pragmatische.
Beim ersten Herangehen erweist es sich als zweckmäßig, die Aufmerksamkeit der Psychologen auf die Lösung folgender Fragen zu lenken:
- In jedem Teil der Handbibliothek muß es einen Arbeitsplatz für den diensthabenden Bibliothekar geben. Muß sein Ort vorrangig mit der Funktion des Schutzes der Bestände verknüpft sein oder mit der Funktion, den Lesern Hilfe zuteil werden zu lassen? Wie viele Arbeitsplätze müssen dem Bibliothekar in der Handbibliothek zur Verfügung gestellt werden? Üblich ist ein Arbeitsplatz für jeden Mitarbeiter. Jedoch jede der genannten Funktionen sowie das beim Bibliothekar ebenfalls sich ergebende Gefühl des Überganges von der Erfüllung einer Funktion zur anderen können anregen, dass man mehrere Arbeitsplätze einrichtet. In diesem Falle erfolgt eine Veränderung der Situation, die Monotonie der Arbeitsumwelt wird verringert und die Konzentrationsfähigkeit stellt sich um. Das können entsprechende psychologische Forschungen bestätigen oder widerlegen.
- Wie soll der Arbeitsplatz des Bibliothekars beschaffen sein? Soll er zum ruhigen Gespräch mit dem Leser geeignet sein oder zum Geben von kurzen Antworten auf seine Frage? Der Tisch oder das Pult für Gespräche trennen die Gesprächspartner, von denen der eine (Leser) immer steht. Davon hängt auch die psychologische Situation des Bibliothekars hinsichtlich der Kommunikation mit dem Leser ab.
- Wenn die Lesezone eine große Fläche einnimmt, dann nimmt die natürliche Beleuchtung des Arbeitsplatzes ab je weiter dieser von den Fenstern entfernt ist. Es ergeben sich Alternativen bei der Auswahl der Prioritäten: Entweder eine zentrale Lage des Arbeitsplatzes des Bibliothekars im Lesesaal oder seine gute Ausleuchtung mit natürlichem Licht.
- In vielen Fällen erfolgt die bibliographische Konsultation gleichzeitig durch mehrere Bibliographen. Der Computerkatalog macht es möglich, die Arbeitsfläche für bibliographische Dienstleistungskonsultationen angesichts der Computerklasse zu organisieren, in der die diensthabenden Bibliographen frei von einem Leser zum anderen wechseln können, um ihm praktische Hilfe zu geben und um sie gleichzeitig in der Arbeit mit dem Computerkatalog zu unterweisen. Entsprechend ändert sich auch die Qualität der bibliographischen Konsultationen und die ganze räumliche Organisation dieses Teiles der Lesezone. Damit werden ausreichende Möglichkeiten für die Flexibilität dieses Teiles der Lesezone geschaffen. Das ist im Interesse des Bibliographen und des Lesers.
- Wenn der Bibliograph in der Lesezone mit den Lesern kommuniziert, dann stimuliert das ständig seine Aktivität und erfordert die erhöhte Aufmerksamkeit im Laufe des gesamten Arbeitstages, was zu psychischen Überlastungen führt. Die Arbeitsfläche des Bibliographen muß die Möglichkeit bieten, dass er zwischen mehr oder weniger angespannten Abschnitten wechseln kann, wodurch sich ein Situationswechsel und eine Verminderung der psychischen Belastung ergibt.
Auf den ersten Blick kann man feststellen, dass die Antworten auf diese und viele andere Fragen an der Oberfläche liegen und mit Hilfe des gesunden Menschenverstandes gelöst werden können. Aber das Problem liegt an den Menschen und an deren unterschiedlichem "gesunden Menschenverstand". Manche Aufgaben, die sich auf den ersten Blick als einfach darstellen, erweisen sich bei einer gründlicheren Analyse als schwierig und bieten völlig unerwartete Lösungen.
9. Die Verbindung der Lesezone mit der internen Arbeitszone und den Magazinen
Die Einrichtung der Lesezone innerhalb der Gesamtstruktur des Bibliotheksgebäudes ist immer abhängig von deren Transportverbindungen zu anderen Bibliothekszonen. Die zentrale Frage der Verbindung der Lesezone mit der internen Arbeitszone verlangte traditionell die Nähe der Katalogisierungsabteilung zu den Leserkatalogen auf der einen Seite sowie der Komplettierungs- bzw. Ergänzungsabteilung auf der anderen Seite. Wenn wir vom gegenwärtig existierenden und dem künftigen Niveau des Eindringens von Computerkatalogen und Computernetzen ausgehen, dann ist es wahrscheinlich, dass man auch die Beziehungen zu den Transportverbindungen der Lesezone und der internen Arbeitszone überdenken muß, auf jeden Fall in dem Maße, in dem sie die Katalogisierungsabteilung betreffen, die ja am aktivsten mit der Lesezone verbunden ist.
Die Verbindung der Lesezone mit den Magazinen entspricht dem Streben nach Verkürzung der Entfernungen für den Büchertransport und der schnelleren Befriedigung der Wünsche der Nutzer. Das Eindringen und die Vorzüge von Paternostern in die Bibliothek verlangte die territoriale Einheit dieser beiden Zonen. Historisch war das schon früher bedingt durch den Transport der Bücher mit der Hand. Die gegenwärtigen Transportmittel verlangen nicht mehr eine unbedingte Verbindung dieser beiden Zonen. Das beispielsweise zuverlässig funktionierende Transportsystem Telelift entwickelt eine Geschwindigkeit der Lastenverlagerung von 0,5 bis 0,6 m/s. Eine Vergrößerung der Entfernung der Buchaufbewahrungszone von der Lesezone um 100 m verlängert die Zeit des Büchertransportes auf 166 bis 200 Sekunden. Wenn man folglich alle technologischen Operationen des Prozesses der Suche und Auslieferung der Literatur aus den Magazinen einschätzt, kann man sich davon überzeugen, dass eine solche Verlängerung der Zustellzeit keinen wesentlichen Einflluß ausübt auf die Zeit, die der Nutzer auf die bestellte Literatur wartet.
Unserer Meinung zufolge zieht das Streben nach einer kompakten und gegenseitigen Anordnung aller Zonen des Bibliotheksgebäudes andere Prioritäten nach sich und insbesondere die Möglichkeit der unabhängigen und schrittweisen Entwicklung jeder Zone in Abhängigkeit von der Vergrößerung der Bibliotheksbestände und der Veränderung ihrer Struktur, der Zahl der Nutzer und Mitarbeiter, von Veränderungen hinsichtlich der Rolle der Bibliothek auf dem Informationsdienstleistungsmarkt, von der Entwicklung neuer Informationsträger und von deren Benutzungsmöglichkeiten durch den Leser.
Literatur
- Amlinski, Lev: Die bibliothekswissenschaftliche und die architektonische Projektierung von Bibliotheken als einheitlicher schöpferischer Prozeß. – In: ABI - Technik 12(1992) Nr.1, S. 1 - 16.
- Canter, D.: Architectural Psychology: Proceedings of the Conference held at Dalandhui, University of Strathclyde, 28th February – 2nd March 1969. - London: RIBA Publications, 1970.
- Fuhlrott, R., Liebers, G. und Philipp, F.-H.: Einige Gedanken zum Bibliotheksbau der siebziger Jahre. – In: Bibliotheksneubauten in der Bundesrepublik Deutschland 1968-1983. - Frankfurt am Main: Klostermann, 1983, S. XVIII – XXII.
- Grundlagen des Bibliotheksbaus. Bibliotheksgebäude. - Verantwortliche Hrsg. Dr. Gerhard Schwarz, - Leipzig: Bibliographisches Institut, 1985. 384 S.
- Kaminski, Gerhard: Einführung in den Problemkreis aus der Sicht des Psychologen. – In: Psychologie und Bauen. Kolloquium: Vorträge & Diskussionen. Hrsg. Prof. Dr.- Ing. Jürgen Joedicke. – Stuttgart: Karl Krämer Verlag, 1975. S. 14.
- Koffka; Betina M.: Die kreative Arbeitsumwelt. Ein Beitrag zur Ökologischen Psychologie und Architekturpsychologie. - Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, 1996. 672 S.
- Lym, Glenn Robert: A Psychology of Building. – Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, Inc., 1980. 155 S.
- Zimmermann, Gerd: Der gläserne Nutzer. Zur Funktionalisierung des architekturpsychologischen Denkens. - In: Psychologie des Wohnungs- und Siedlungsbaus. Hrsg. v. Hans Joachim Harloff. - Göttingen: Verlag für Angewandte Psychologie, 1993, 213 S.
Zum Autor
Prof. Dr. habil. paed., Dr.-Ing. Lev Amlinski
ist Geschäftsführer des Informationszentrums <InformA>
D-10117 Berlin
Fax: (030) 226 7486
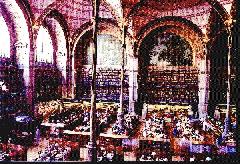 Natürlich kann man nicht zu den historischen Stilen der Vergangenheit zurückkehren bzw. sich diese Aufgabe ernsthaft stellen. Die gegenwärtige architektonische Konzeption der Einrichtung einer Lesezone in Bibliotheksgebäuden hat eine rationale Grundlage - die soziale Gleichstellung der angebotenen bibliothekarischen Dienstleistungen und die funktionale Zusammenführung der inneren Planung mit den zu bewältigenden bibliothekarischen Prozessen. Man könnte viele Beispiele hervorragender Bibliotheksgebäude anführen, in denen gerade diese Prinzipien der Bibliotheksarchitektur zur Anwendung kamen.
Natürlich kann man nicht zu den historischen Stilen der Vergangenheit zurückkehren bzw. sich diese Aufgabe ernsthaft stellen. Die gegenwärtige architektonische Konzeption der Einrichtung einer Lesezone in Bibliotheksgebäuden hat eine rationale Grundlage - die soziale Gleichstellung der angebotenen bibliothekarischen Dienstleistungen und die funktionale Zusammenführung der inneren Planung mit den zu bewältigenden bibliothekarischen Prozessen. Man könnte viele Beispiele hervorragender Bibliotheksgebäude anführen, in denen gerade diese Prinzipien der Bibliotheksarchitektur zur Anwendung kamen. 

