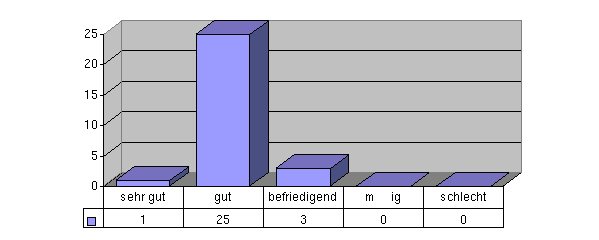
Lernen in der Zukunft - E-Learning versus Blended Learning:
STRuPI - ein Forschungsprojekt an der HAW Hamburg
von Ute Krauß-Leichert
1. Lebenslanges Lernen
Das Konzept des "Lebenslangen Lernens" hat zur Zeit einen Stellenwert wie nie zuvor. Als eine Möglichkeit lebenslanges Lernen umzusetzen, wurden in den letzten Jahren zunehmend Lernszenarien mit Unterstützung von E-Learning diskutiert und umgesetzt.
1.1 Welche Vorteile bietet E-Learning, welche Potenziale stecken in dieser Lernmethode?
Räumliche und zeitliche Flexibilität:
E-Learning ermöglicht den Abruf von Lehrmaterialien zu einem beliebigen Zeitpunkt, d.h. zu jeder Tages- und Nachtzeit, und von einem beliebigen Ort (entsprechend der eigenen Wahl) aus. Diese Flexibilität und Unabhängigkeit ist vor allem für den Bereich der Weiterbildung wichtig. Die meisten Arbeitnehmer haben keine Möglichkeit und keine Zeit, sich am Arbeitsplatz weiterzubilden. Sie sind darauf angewiesen, sich nach Dienstschluss weiterzubilden. Lernwilligen, die weit entfernt von Ausbildungsinstitutionen leben, wird mit E-Learning die Möglichkeit geboten, an Ausbildungsangeboten zu partizipieren. Auch für manche Behinderte bietet diese Lernmöglichkeit Vorteile, vor allem im Hinblick auf räumliche Flexibilität.
Individualisierung des Lernens:
Der Lernende verfügt über Freiräume in der Gestaltung seines Lernprozesses. Er kann die Lerninhalte, Lernwege und Lerntempo selbst bestimmen, d.h. die Selbstbestimmtheit des Lernens wird durch diese Methode am besten gewährleistet (eigenverantwortliches Lernen) (vgl. Glatt 2002, S. 165).
Größeres und aktuelleres Angebotsspektrum:
Durch E-Learning-Angebote im Internet kann der Lernende auch auf Angebote räumlich entfernter (d.h. auch ausländischer) Aus- und Weiterbildungsinstitutionen zugreifen. Außerdem können in E-Learning-Modulen neuere Informationen schneller eingearbeitet, publiziert und verbreitet werden. D.h. die Anbieter von E-Learning können neue Entwicklungen jederzeit in ihre Lehrmaterialien einbauen und dadurch immer aktuell halten.
Effektives Lernwerkzeug durch multimediale Aufbereitung der Lehrinhalte:
Bilder, Grafiken, Simulationen oder Videos erleichtern das Verständnis komplexer Sachverhalte und stärken somit die Motivation des Lernenden. Lebendigkeit ist ein wichtiger Punkt beim Lernen, das ist auch in der E-Learning-Branche bekannt und liefert ihr eins der zentralen Argumente: "Wer handelnd lernt, lernt besser, ist interessierter und höher motiviert: Er hat Spaß am Lernen." (Lippoth /Schweres 2004).
Förderung der Medienkompetenz:
Durch die Teilnahme an E-Learning-Kursen wird neben dem eigentlichen Wissenserwerb der Umgang mit neuen Informations- und Kommunikationstechnologien geschult (E-Mail, Chatrooms, Mailing-Lists). Durch die Nutzung der Kommunikationspotenziale des Internets wird die Kommunikation zwischen Lehrenden und Lernenden gefördert (im Vergleich zum Fernstudium). Der Austausch der Lernenden untereinander kann kreatives Lernen fördern.
1.2 Welche Nachteile haben E-Learning-Angebote?
Begrenzte soziale Austauschmöglichkeiten:
Die Qualität der Kommunikation und Interaktion in face-to-face-Lehrveranstaltungen ist natürlich nicht bei der Kommunikation über Datennetze zu erreichen. Der fehlende persönliche Kontakt zu Lehrer und anderen Lernenden kann als Anonymisierung empfunden werden.
Motivation:
Das selbstgesteuerte Lernen verlangt ein großes Maß an Eigenmotivation und Selbstdisziplin. Es ist bekannt, dass beim traditionellem Fernstudien hohe Abbrecherquoten zu erwarten sind.
Technische Voraussetzungen:
E-Learning verlangt eine entsprechende technische Ausstattung. Die Unabhängigkeit und Flexibilität des Lerners kann eingeschränkt sein, wenn der Lernende auf die Nutzung von Computerräumen angewiesen ist. Ein privater Anschluss kann allerdings zu hohen Kosten führen, wenn für die Lerneinheiten sehr viel Zeit aufgewendet werden muss. Ein stabiler und störungsfreier Zugang zum Netz muss gewährleistet sein.
Internet-Grundkenntnisse:
Das webbasierte Lernen verlangt vom Lernenden ein gewisses Maß an technischen Basiswissen und Erfahrungen in der Nutzung des Internets. Diese Anforderungen stellen besonders Hürden für diejenigen dar, die in der Schule oder im Arbeitsalltag wenig oder gar nicht mit dem Internet arbeiten.
Unzureichende didaktische Konzepte:
Das größte Problem bei E-Learning-Angeboten ist die oftmals festzustellende unzureichende didaktische Konzeption. Oftmals werden vorhandene gedruckte Lehrmaterialien einfach als E-Learning-Materialien ins Netz gestellt, ohne dass sie speziell didaktisch überarbeitet worden sind. Bei E-Learning-Angeboten geht es nicht um die bloße Bereitstellung von Wissen, sondern um seine Aufbereitung. Nicht selten werden Fragen der Didaktik denen der Technik (hardware-driven Vorgehensweise) oder des Designs nachgestellt. Dabei hängt der Erfolg multimedialer Lernumgebungen in erheblichem Maße von der Qualität didaktischer Aufbereitung der Lerninhalte ab.
Wenn man die vielen E-Learning-Angebote betrachtet, die auf dem Markt sind, muss festgestellt werden, dass gegenwärtig noch eine große Diskrepanz zwischen den Möglichkeiten der neuen Informations- und Kommunikationstechnologien auf der einen Seite und ihrem realen Einsatz für Lehr- und Lernzwecke auf der anderen Seite besteht. Die Planung und Entwicklung von multimedialen Lernangeboten sollte als interdisziplinäres Aufgabenfeld betrachtet werden. So sollten insbesondere Informatiker, Designer, Mediendidaktiker, Fachexperten und Pädagogen an Planungsprozessen beteiligt sein. Wichtig ist bei der Entwicklung von E-Learning-Angeboten, dass es den Beteiligten klar ist, dass es sich um einen Lernprozess handelt und dass dafür Lernstrategien bzw. Bildungsstrategien definiert werden müssen (vgl. Glatt, 2002, S. 166).
1.3 Bibliotheken als Partner für lebenslanges Lernen
Trotz aller Nachteile überwiegen in vielen Fällen die Potenziale von E-Learning. E-Learning ermöglicht das lebenslange Lernen, so wie es ist von Institutionen und Organisationen, Hochschulen und der Wirtschaft gefordert wird.
Bereits 1996 wurde von der Europäischen Kommission das "European Year of Lifelong Learning" ausgerufen. 2001 veranstaltete die Europäische Kommission eine Tagung in Brüssel zum Thema "europaweite Strategien des lebenslangen Lernens". Die UNESCO hatte die Forderung nach "Bildung für alle als Chance zum lebenslangen Lernen" zum Schwerpunkt ihrer mittelfristigen Strategie für den Zeitraum 1996-2001 erklärt. In allen diesen Kampagnen wird im Grundsatz betont, dass alle Bürger lebenslang lernen müssen, um die notwendige Weiterentwicklung der Informationsgesellschaft zu einer von allen Bürgern mitgetragenen Wissensgesellschaft zu realisieren.
Für die Förderung des lebenslangen Lernens sind Bibliotheken eine wichtige Infrastrukturmaßnahme. Bibliotheken sind wichtige Partner im Bildungsnetzwerk. Sie sind der Ausgangspunkt für das Erlernen von Methoden zum Umgang mit Informationen und zur Erschließung von Wissen. Bibliotheken bieten Unterstützung bei der kompetenten Nutzung des Internets und anderer elektronischer Quellen. Neben der Lesefähigkeit "literacy" ist in der heutigen Welt immer mehr die "information literacy" wichtig. Damit ist die Fähigkeit gemeint, Informationen zu finden, zu bewerten und mit ihnen umzugehen (vgl. BDB 2000, S. 57). Bibliotheken bieten den qualitätsgesicherten Zugang zu Informationen und wirken damit einer digitalen Spaltung der Gesellschaft in Informierte und Nichtinformierte entgegen (vgl. Bertelsmann Stiftung 2004, S. 11).
Bibliothekare erhalten im Zusammenhang mit der Unterstützung von lebenslangem Lernen immer mehr die Aufgabe, Bibliotheken als Lernzentren zu etablieren. Schulungsaufgaben werden verstärkt in Bibliotheken angeboten. Das verlangt nach neuen Qualifikationen von Bibliothekaren. Die bibliothekarischen Tätigkeiten verändern sich. Bibliothekare müssen selbst neue Lerntechniken erlernen oder sie müssen neue Lerntechniken unterstützen. Dieser neuen Entwicklung wird auf der IFLA Konferenz 2004 in Buenos Aires Rechnung getragen, indem eine Discussion Group zum Thema E-Learning einberufen wird.
"E-Learning is playing an increasingly significant role in our professional lives, either as a medium through which we learn, or as an activity that our library services must support. The IFLA Professional Committee, at the request of the Education and Training Section and the Continuing Professional Development and Workplace Learning Section, has approved the inclusion of a discussion session on E-Learning in the IFLA Conference programme." (Call for Presentations IFLA 2004)
1.4 E-Learning-Aktivitäten in der deutschen Wirtschaft
Bevor E-Learning in der bibliothekarischen Berufswelt eingeführt wurde, war diese Lernmethode schon lange Zeit ein Thema in der Wirtschaft, vor allem in der betrieblichen Aus- und Weiterbildung.
In Deutschland wird E-Learning in der Wirtschaft nach Sierke vor allem wegen der vermeintlichen Kostenreduktion und nicht wie in den USA wegen des zu erwartenden Wettbewerbsvorteils durch Know-how-Vorsprung eingesetzt (vgl. Sierke, 2002, S. 80). Wer allerdings E-Learning einsetzt, nur um Kosten zu ersparen, hat die Vorteile von E-Learning noch nicht erkannt bzw. noch nicht ausgeschöpft (vgl. Vering 2002, S. 173).
Nach einer von der unicmind.com AG im Frühjahr 2001 in Auftrag gegebenen Studie zur Akzeptanz und Nutzung von E-Learning bei den deutschen Top-350-Unternehmen setzen nahezu 90% aller Firmen bereits E-Learning ein (vgl. Sierke 2002, S. 80). "Entsprechend wird das Marktvolumen für E-Learning nach Untersuchungen des Research Institutes Berlecon in Berlin bis 2005 zwischen 1,5 und 2 Milliarden Euro liegen, das gesamte Marktpotential in Deutschland wird - ausgehend von einem stagnierenden Markt für Aus- und Weiterbildung mit 13,9 Milliarden Euro beziffert" (Beschorner 2003). Ob diese euphorischen Zahlen stimmen, ist allerdings nicht geklärt. Laut einer Studie von KPMG Cosulting "New Learning in deutschen Großunternehmen", die 2002 durchgeführt worden ist, wird davon ausgegangen, dass nur 46% der deutschen Großunternehmen E-Learning im Rahmen der betrieblichen Aus- und Weiterbildung einsetzen (vgl. Kerres 2002, S. 132). 25% geben an, dass E-Learning für sie in absehbarer Zeit kein Thema ist (vgl. Haben 2002, S. 38). In der KPMG-Studie wurden bundesweit über 600 Personalverantwortliche in Unternehmen mit mehr als 1000 Beschäftigten befragt. Der Bildungsalltag in Großunternehmen (ab 1000 Beschäftigten) sieht nach dieser KPMG-Studie heute so aus, dass jeder Mitarbeiter alle zwei Jahre ein vier- bis fünftägiges Weiterbildungsseminar besucht. Für diese Qualifizierung investieren die Unternehmen pro Jahr und Mitarbeiter 750 bis 1000 Euro. 43% davon fließen nicht in die Bildungsveranstaltung, sondern werden für Planung, Organisation und Infrastruktur der Aus- und Weiterbildung benötigt. Somit erreichen die E-Learning-Anwendungen nur knapp jeden zehnten Beschäftigten. Ein großes Problem stellen nach dieser Studie auch die Kosten dar. Die Kosten für E-Learning werden mit etwas über 12% des Gesamtbudgets angegeben, die aber nur 10% der Mitarbeiter zugute kommen, die außerdem noch andere Qualifizierungsangebote wahrnehmen (vgl. Haben 2002, S. 39).
Diese unterschiedlichen Zahlen machen deutlich, wie differenziert die Bedeutung von E-Learning in der betrieblichen Aus- und Weiterbildung eingeschätzt werden muss.
1.5 Wie sieht es mit E-Learning-Aktivitäten im bibliothekarischen Bereich aus?
E-Learning-Angebote im bibliothekarischen Bereich haben unterschiedliche Zielrichtungen. Es gibt E-Learning-Angebote für Studenten, die von Bibliothekaren entwickelt worden sind. Dabei handelt es sich vor allem um Angebote im Bereich des Erlernens und Vermittelns von Informationskompetenz. Als Beispiel dafür kann das Projekt DISCUS (Developing Information Skills & Competence for Universuity Students) aufgeführt werden, das an der Technischen Universität Hamburg-Harburg entwickelt wird (http://www.tub.tu-harburg.de/index/php?id=418)1. Weiterhin gibt es E-Learning-Angebote in der Hochschullehre, die von den Bibliotheken unterstützt werden. Das dritte Standbein sind E-Learning-Weiterbildungsangebote im bibliothekarischen Bereich. Das bekannteste Projekt in Deutschland ist das E-Learning-Projekt der Bertelsmann-Stiftung und der ekz-bibliotheksservice GmbH "bibweb Lernforum für Bibliotheken" (www.bibweb.de).
1.6 Wie sieht es mit E-Learning in der bibliothekarisch-dokumentarischen Hochschul- ausbildung aus?
In Deutschland gibt es mittlerweile einige Veranstaltungen in der bibliothekarisch-dokumentarischen Hochschulausbildung, die mit E-Learning-Plattformen arbeiten, auch länderübergreifend. Beispielsweise habe ich ein Seminar mit der Fachhochschule Burgenland in Eisenstadt/Österreich, Studiengang Informationsberufe durchgeführt, das als Thema die "Rolle der Frau in Bibliotheken und Informationseinrichtungen" (http://www.bui.haw-hamburg.de/pers/ute.krauss-leichert/Aktiv-fh/Glow/text/Frames.html) hatte (vgl. Merschitzka / Krauss-Leichert 2002). Dieses interkulturelle Online-Seminar wurde von den Studentinnen sehr gut angenommen. Dabei stand vor allem der interkulturelle Austausch und das gegenseitige Kennen lernen im Vordergrund2.
Neben der Arbeit mit E-Learning-Plattformen, wie GLOW, WebCt, Blackboard oder Clix bzw. eigenentwickelten Plattformen, wie ELAT (vgl. Leichtweiß u.a. 2004) existieren in der bibliothekarisch-dokumentarisch Hochschulausbildung E-Learning-Angebote, die vor allem als einzelne Module konzipiert worden sind. Diese Module sind meist Einzelinitiativen von Professorinnen oder Professoren3 und werden vor allem aus Forschungsmitteln unterstützt4.
2. Das Projekt STRuPI online-offline
2.1 Beschreibung
Im Folgenden wird ein Projekt näher beschrieben, in dem ein E-Learning-Modul in der bibliothekarischen Hochschulausbildung benutzt und evaluiert wird: das Projekt STRuPI - Online - Offline (STRukturen Und Politik des Informationssystems - Online und Offline). Dem Projekt "STRuPI" liegt ein E-Learning Modul zugrunde, das ursprünglich für das Forschungsprojekt "Virtuelle Fachhochschule" von Prof. Dr. Wolfgang Swoboda und mir entwickelt worden ist. Ziel des Projektes "Virtuelle Fachhochschule" war es, Online-Studiengänge mit international anerkannten Abschlüssen zu schaffen und über das Internet für Studium und Weiterbildung verfügbar zu machen (www.oncampus.de). Es wurde vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (bmb+f) gefördert und mit über 20 Mio. Euro unterstützt. Innerhalb dieses Projekt wurde u.a. ein Bachelor-Studiengang Medieninformatik entwickelt (vgl. Bildung online 2002). Teile des von mir dafür entwickelten E-Learning-Moduls "Medienwirtschaft und Kommunikationspolitik" werden von mir in dem Studiengang "Bibliotheks- und Informationsmanagement" am Fachbereich Bibliothek und Information der HAW Hamburg eingesetzt.
Dieses Modul "Medienwirtschaft" ist Ausgangspunkt für ein Projekt, in dem es darum geht, E-Learning-Angebote zu evaluieren. Das Ziel des Projektes STRuPI war die Entwicklung und Erprobung von effektiven Lernstrategien für die Studierenden. Entsprechend wird im Folgenden nicht auf die Inhalte oder die didaktische Aufbereitung des Moduls eingegangen sondern auf die Bewertung solch eines Online-Moduls im Unterricht. Darauf aufbauend wird das Für und Wider solcher E-Learning-Module aus der Sicht der Studierenden aufgelistet.
Das Projekt "STRuPI online - offline" wird von der Behörde für Wissenschaft und Gesundheit (BWG) der Freien und Hansestadt Hamburg aus den Mitteln des Förderprogramms E-Learning und Multimedia in der Hochschullehre "Seminare ans Netz" von März 2003 bis Juli 2004 gefördert und wird von mir geleitet.
Hintergrund dieses Projektes ist die zunehmende kritische Einschätzung von reinen E-Learning-Angeboten. Die fachliche Diskussion akzentuiert zunehmend Blended Learning-Angebote, d.h. einen Wechsel zwischen Online-Angeboten und Präsenzunterricht (vgl. Reiss 2003, Volkmer 2003). Blended Learning bringt die Lerner in realen Treffen zusammen. Dadurch wird die Kommunikation und die Kollaboration gefördert. Diese Kollaboration steigert beispielsweise die Motivation der Lerner und das Durchhaltevermögen in Lehrgängen (vgl. Ruisz / Hummel / Krcmar 2003, S. 23). Daher wurden in diesem Projekt neben der traditionellen Seminarform der zusätzliche Einsatz innovativer multimedialer Lehr- und Lerneinheiten im Unterricht erprobt und bewertet. Als E-Learning-Plattform wurde WebCT (www.webct.com) benutzt.
Ziel des Projektes war, dass die Studierenden
Das Online-Modul "Medienwirtschaft" wurde im Grundstudium im ersten und zweiten Semesters des Studiengangs Bibliotheks- und Informationsmanagements eingesetzt. Es wurden die Einschätzungen der Studierenden zum Online-Lernen erfragt. Vergleichend dazu wurde der "normale" Präsenzunterricht des Faches "Strukturen und Politik des Informationssystems" evaluiert.
2.2 Evaluation
Die Evaluation fand am Ende des zweiten Semesters statt. Die Semesterevaluationen werden in der Regel in der letzten Stunde der Veranstaltung durchgeführt. Die Teilnahme an solchen Befragungen ist freiwillig. 29 Studierende des 2. Semesters Bibliotheks- und Informationsmanagement nahmen an der Befragung teil.
Bei der Befragung wurden neben globalen Einschätzungen der Veranstaltung5 auch der Unterrichtsstil und das Engagement der Dozentin evaluiert. Das Hauptaugenmerk wurde aber auf das Online-Lernen versus dem Präsenzunterricht gelegt.
Insgesamt gesehen haben die Studenten die Veranstaltung überwiegend positiv beurteilt.
2.2.1 Geben Sie bitte zunächst einige globale Urteile über die Veranstaltung ab
2.2.1.1 Ich fand die Veranstaltung
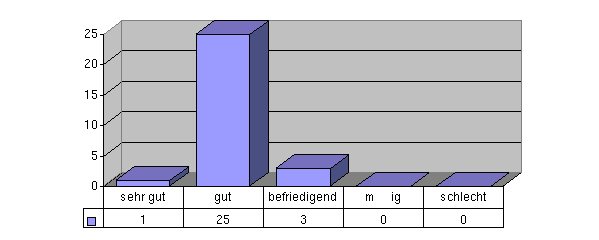
2.2.2 Wie Sie wissen, hatte diese Veranstaltung experimentellen Charakter.
Beurteilen Sie bitte folgende Aspekte der Veranstaltung:
2.2.2.1 das Lernen mit dem Online-Modul

2.2.2.2 den Präsenzunterricht
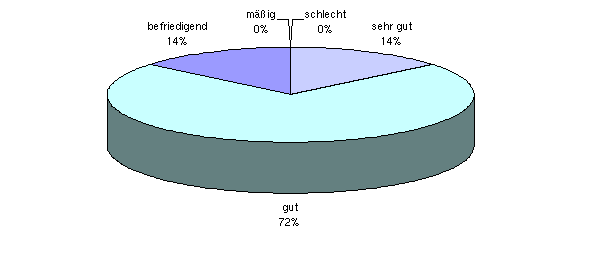
2.2.2.3 den Wechsel zwischen dem Online-Lernen und dem Präsenzunterricht
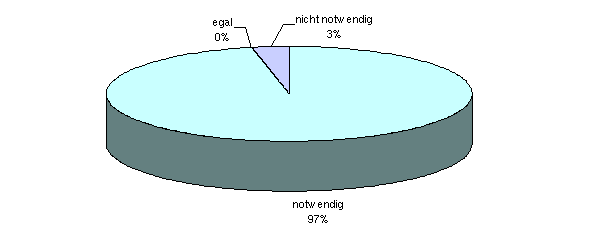
Mehr als 60% der Studenten haben das Online-Lernen mit "gut" bzw. "sehr gut" beurteilt, was eine sehr hohe Akzeptanz dieser Lernmethode bedeutet. Das Lernen mit dem Online-Modul wurde von keinem Studenten als schlecht bewertet. Das Präsenzlernen wurde ebenfalls sehr positiv eingeschätzt, mehr als 80% fanden diese Lernmethode "gut" bzw. "sehr gut".
Insgesamt hat der "traditionelle" Präsenzunterricht in der Einschätzung der Studierenden etwas besser abgeschnitten als das Lernen mit dem Online-Modul. Trotz der positiven Einschätzung des Online-Lernens waren insgesamt 90% der Studierenden der Meinung, dass ein Wechsel zwischen Online-Lernen und dem Präsenzunterricht "notwendig" sei.
Insgesamt empfanden die Studenten das Online-Lernen als eine positive und interessante Erfahrung. Die überwiegend positive Einstellung der Studenten zum Online-Lernen zeigt sich in den nachfolgenden Kommentaren zu den unterschiedlichen Lehrformen:
Kommentare zum Online-Lernen
Pro:
Contra:
Kommentare zum Präsenzunterricht
Pro:
Contra:
Die Kommentare der Studierenden unterstützen bzw. präzisieren die Aussagen zu den allgemeinen Vor- und Nachteilen von E-Learning, die im ersten Teil des Artikels von mir aufgelistet worden sind.
Um die Bewertung der unterschiedlichen Lernformen zu akzentuieren, wurde bei der Befragung explizit nach der Bevorzugung einer bestimmten Lernmethode gefragt. Hier zeigte sich eine eindeutige Präferenz für einen Wechsel in der Lernmethode, d.h. für eine Wechsel zwischen dem klassischen Präsenzunterricht und dem Online-Lernen.
2.2.2.4 Wenn Sie die Auswahl hätten, welchen Unterrichtsstil würden Sie bevorzugen?
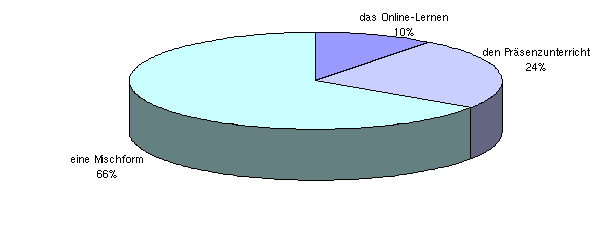
Mit dieser eindeutigen Präferierung zeigt sich, dass von den Studenten eher das Blended-Learning, die Mischform von Online-Lernen und Präsenzunterricht, bevorzugt wird, denn ein reines E-Learning-Angebot. Dieses Ergebnis unterstreicht die Aussage, die man in unterschiedlichen Quellen liest6, dass Blended Learning-Modelle viele Vorteile gegenüber dem reinen E-Learning aufweisen.
3. Ausblick: E-Learning - neue Aufgabe für Bibliothekare?
Rückblickend kann für E-Learning-Aktivitäten in Deutschland fest gestellt werden, dass der Erfolg der neuen Lernform mühsamer ist als viele - vor allem in der Anfangszeit - gedacht haben. Sehr viele Prognosen der Vergangenheit haben sich als falsch erwiesen (vgl. Kerres 2002, S. 132). In einigen Presseberichten spricht man sogar vom "Patient E-Learning" oder "Platzen der E-Learning-Blase" (Lippoth/Schweres 2004). Mittlerweile hat sich der Patient E-Learning wohl erholt und ist in eine neue Phase eingetreten, eine Phase, bei der es um Lernstrategien (Learning Architecture) (vgl. Glatt, 2002, S. 166), um Möglichkeiten des lebenslangen Lernens geht. Diese Strategien müssen in einem entsprechenden Kontext - dem Betrieb oder der Hochschule oder der Bibliothek - eingebettet sein.
Wichtig ist, dass Bibliothekare sich dieser Problematik stellen, indem sie entweder die Entwicklung von E-Learning-Modulen unterstützen oder selbst E-Learning-Module entwickeln bzw. sich selbst mit E-Learning-Angeboten weiterbilden. In einem Online-Seminar der Association of College & Research Libraries, einer Division of the American Library Association, das im April 2004 angeboten worden ist, wird vom "blended librarian" gesprochen. "A blended librarian is one who combines traditional library and information skills with instructional design and technology skills and knowledge of collections of instructional resources and current trends in developing and distributing instructional resources. The blended librarian uses this combination, along with a heigthened emphasis on pedagogy, to collaborate with faculty, information technologists, and instructional technologists/designers on the design of information literacy that is tightly integrated into the individual instructor's courses and with broader programmatic goals." (www.ala.org/ACRLPrinterTemplate.cfm?Section=acrlproftools&Template=/Co..., 2004-03-01).
Dieser "blended librarian" wird die E-Learning-Zukunft in der bibliothekarischen Berufswelt forcieren. E-Learning - eine neue Aufgabe für Bibliothekare - fangen wir an!
Literatur
Beschorner, Harald (2003)
Die Software behält den Überblick. E-Learning - kurzfristiger Trend oder dauerhafte Entwicklung? In: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 24.09.2003
BDB (2000)
Berufsbild 2000. Bibliotheken und Bibliothekare im Wandel. Career Profile 2000. The Changing Roles of Libraries and Librarians. Erarb. Von der Arbeitsgruppe Gemeinsames Berufsbild der BDB e.V. unter Leitung von Ute Krauss-Leichert. 2., unveränd. Nachdr. d. dt. Fassung, erg. um die engl. Vers. Wiesbaden: Dinges & Frick 2000
Bertelsmann Stiftung / Bundesvereinigung Deutscher Bibliotheksverbände (Hrsg.) (2004)
Bibliothek 2007. Strategiekonzept. Gütersloh: Bertelsmann Stiftung 2004
Bildung online (2002)
Die virtuelle Fachhochschule. Symposium am 23. April 2002 in Berlin
Brach, Robert / Georgy, Ursula (2004)
eLearning - ein Modul für den gewerblichen Rechtsschutz. In: Ockenfeld, Marlies (Hrsg.): Information Professional 2011. Strategien - Allianzen - Netzwerke. 26. Online-Tagung der DGI. Proceedings. Wiesbaden: DGI, 2004. S. 297-306
Glatt, Thomas (2002)
Blended Learning: Top oder Flop? In: Schwuchow, Karlhein u.a. (Hrsg.): Jahrbuch Personalentwicklung und Weiterbildung 2003. Neuwied: Luchterhand 2002, S. 165-172
Haben, Michael (2002)
Die meisten Konzepte greifen nicht : Online-Lernen in deutschen Großunternehmen. In: Computerwoche. - München. - 29. 2002, 22. - S. 38-39
Hagemann, Gisela (2003)
Degussa: Blended Learning steigert Lerneffizienz. In: Wirtschaft und Weiterbildung; 2003, Heft: 7/8, S. 50-53
Hapke, Thomas / Marahrens, Oliver (2004)
Spielen(d) lernen mit DISCUS. Förderung von Informationskompetenz mit einem E-Learning-Projekt der Universitätsbibliothek der TU Hamburg-Harburg. In: Ockenfeld, Marlies (Hrsg.): Information Professional 2011. Strategien - Allianzen - Netzwerke. 26. Online-Tagung der DGI. Proceedings. Wiesbaden: DGI, 2004. S. 203-217
Kerres, Michael (2002)
Didaktische Konzepte für erfolgreiches E-Learning. In: Schwuchow, Karlhein u.a. (Hrsg.): Jahrbuch Personalentwicklung und Weiterbildung 2003. Neuwied: Luchterhand 2002, S. 131-139
Kerrinnes, Uwe (2002)
Bessere Inhalte anstatt mehr Technik. In: Computerwoche. - München. - 29. 2002, 22. - S. 36-37
Leichtweiß, Angela u.a. (2004)
2MN - Evaluation digitaler Wissensvermittlung. In: Ockenfeld, Marlies (Hrsg.): Information Professional 2011. Strategien - Allianzen - Netzwerke. 26. Online-Tagung der DGI. Proceedings. Wiesbaden: DGI, 2004. S. 233-251
Lippoth, Karl Ulrich / Schweres, Manfred (2004)
E-Learning braucht Kontinuität. Mehr nicht? 19.02.2004
http://www.heise.de/bin/tp/issue/d...16782&rub_ordner=inhalt&mode=print
Merschitzka, Heike / Krauss-Leichert, Ute (2002)
Lernen ohne Grenzen - ein Hybridseminar der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg und des Fachhochschul-Studienganges Informationsberufe Eisenstadt/Ö. E-Learning-Erfahrungen zum Thema "Die Rolle der Frau in Bibliotheken und Informationseinrichtungen". In: Information. Wissenschaft & Praxis 53(2002), Nr. 7, S. 419-422
Reiss Michael (2003)
Kunden erwarten Medienmix. In: Personalwirtschaft. - 2003, Heft: 8, S. 39-41
Ruisz, Roland / Hummel, Sandra / Krcmar, Helmut (2003)
Kollaboration als Motivationsfaktor im E-Learning : Blended Learning als Rettungsring? In: IM Die Fachzeitschrift für Information Management & Consulting, Nr. 1, 2003, S. 23-28
Schwuchow, Karlheinz / Gutmann, Joachim (Hrsg.) (2002)
Jahrbuch Personalentwicklung und Weiterbildung 2003. Praxis und Perspektiven. Neuwied: Luchterhand 2002.
Sierke, Bernt R. (2002)
Online-Wissensmanagement und E-Learning in der Finanzwirtschaft. In: Betriebswirtschaftliche Blätter 51(2003), 2, S. 80-83
Vering, Juliane (2002)
Web-Based-Training in der betrieblichen Aus- und Fortbildung. In: Schwuchow, Karlhein u.a. (Hrsg.): Jahrbuch Personalentwicklung und Weiterbildung 2003. Neuwied: Luchterhand 2002, S. 173-180
Volkmer, Ralf (2003)
Blended Learning : Synergieeffekte durch den richtigen Medien- und Methodenmix. In: Wissensmanagement, Heft: 1, 2003, S. 19-21
http://www.bui.haw-hamburg.de/pers/ute.krauss-leichert/Aktiv-fh/Glow/text/Frames.html (2004-06-19)
www.oncampus.de (2004-06-19)
www.ala.org/ACRLPrinterTemplate.cfm?Section=acrlproftools&Template=/Co (2004-03-01)
Anmerkungen
1. Vgl. dazu den ausführlichen Bericht über das Projekt, den Herr Hapke und Herr Marahrens auf der 26. DGI-Online-Tagung gehalten haben: Hapke, Thomas / Marahrens, Oliver: Spielen(d) lernen mit DISCUS (2004).
2. Zu dieser Veranstaltung ist ein Sammelband geplant mit dem Titel "Interkulturelles Online Lernen", der 2004 im Verlag Budrich herauskommen wird.
3. Beispielsweise ein E-Learning-Modul zum gewerblichen Rechtsschutz, vgl. Brach, Georgy 2004.
4. Beispielhaft sei genannt "2MN - Module für die multimediale netzbasierte Hochschullehre", vgl. Leichtweiß u.a.
5. Beispielsweise wurde gefragt, wie gerne die Studenten die Veranstaltung besucht haben, wie viel Nützliches sie für ihr weiteres Studium gelernt haben etc.
6. Vgl. dazu beispielsweise Glatt (2002), Hagemann (2003) oder Ruisz/Hummel/Krcmar (2003).
Zur Autorin
Prof. Dr. Ute Krauß-Leichert
Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW) Hamburg
FB Bibliothek und Information
Berliner Tor 5
D-20099 Hamburg
E-Mail: ute.krauss-leichert@bui.haw-hamburg.de
URL: www.bui.haw-hamburg/pers/ute.krauss-leichert