Digitalisierungsstrategien für gefährdete Archivbestände
Besuch in einem modernen Archiv mit digitalem Lesesaal
Wer bei einem Archiv an einen weltfernen dunklen Ort voll verstaubter alter
Akten und Bücher denkt, wird sich bei einem Besuch des
Personenstandsarchivs in Brühl (www.archive.nrw.de)
sehr schnell von dieser klischeehaften Erwartung verabschieden. Ein
heller freundlicher Lesesaal erwartet den Besucher in einem
Seitentrakt des kurfürstlichen Schlosses, das in die von der
UESCO geführten Liste der Weltkulturerbestätten aufgenommen wurde.
Bilder:Gisela Fleckenstein

Blick auf den Seitenflügel des kurfürstlichen Schlosses, der den
Lesesaal des Archivs beherbergt.

Blick in den Lesesaal mit Computer- und Mikrofiche- Arbeitsplätzen
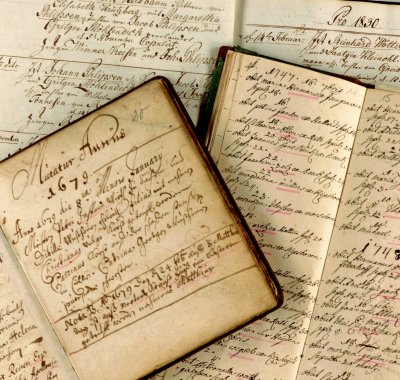
Einige Archivalien zur Ansicht: Kirchenbücher des 17.- 19.
Jahrhunderts (LAV NRW PSA Brühl BA 89 Bachem, BA 101 Baerl, BA 137 Beeck)

Gisela Klein bei der Scanarbeit
Das Personenstandsarchiv Brühl, zwischen Köln und Bonn gelegen,
ist seit Januar 2004 eine Abteilung des damals gegründeten
Landesarchivs Nordrhein-Westfalen. Die räumliche Zuständigkeit
erstreckt sich auf die Regierungsbezirke Düsseldorf und Köln.
Neben zwei zentralen Verwaltungsabteilungen in Düsseldorf und
einem technischen Zentrum in Coerde sind noch weitere Archivstandorte
in Detmold, Düsseldorf und Münster Teil des Landesarchivs.
Besucherzahlen des Personenstandsarchivs Brühl
| Jahr
| Besucherzahlen
| Benutzte Archiveinheiten |
| 2005
| 3.354
| 87.926 |
| 2006
| 3.397
| 87.398 |
| 2007
| 1.613 (Stand 30.06.2007)
| 40.453 (Stand 30.06.2007)
|
Der unkundige Archivbesucher wird sicherlich mit Erstaunen registrieren,
wie viel Technik in dem Lesesaal für die Benutzer bereitsteht.
24 der insgesamt 30 Arbeitsplätze verfügen über eine
EDV-Ausstattung modernsten Standards, an den sechs übrigen
Arbeitsplätzen stehen Mikrofichelesegeräte bereit. Schnell
wird deutlich: Auch Archive sind längst im digitalen Zeitalter
angekommen und bieten den Besuchern den Zugriff auf viele Archivalien
nicht mehr nur auf Mikrofilm oder Mikrofiche an, sondern zunehmend
auch in Form digitaler Bilder. Aus Gründen der Bestandserhaltung
werden originale Unterlagen in Brühl wie auch in vielen anderen
Archiven den forschenden Besuchern ohnehin nur in Sonderfällen vorgelegt.
Dr. Christian Reinicke, Leiter des Archivs, und seine Stellvertreterin
Dr. Gisela Fleckenstein berichten über die letzten technischen
Neuerungen: "Seit Mitte Mai haben wir im Bereich des Landesarchivs
Nordrhein-Westfalen eine Art digitalen Lesesaal verwirklicht. Jeder
Besucher eines Archivstandortes hat über die EDV-Arbeitsplätze
Zugriff auf ein digitales Bildarchiv im Intranet. Dort sind alle
Digitalisate, die bislang in den Abteilungen des Landesarchivs
angefertigt wurden, abrufbar. Für die Bildansicht wurde eigens
in Zusammenarbeit mit dem Technischen Zentrum des Landesarchivs ein
komfortabler Viewer entwickelt, der auch die Funktionen
Seitenspiegelung und Konversion in eine Negativansicht bietet." Die
Resonanz der vielen Nutzer sei bislang überaus positiv.
Das will etwas heißen, denn die Kunden des Brühler Archivs sind
eine kritische Klientel. Da das Archiv seinem Widmungszweck
entsprechend personenstandsbezogene Unterlagen bietet, sind die
Besucher überwiegend Familienforscher. Gerade Genealogen sind
eine Benutzergruppe, die schon sehr frühzeitig ihre Forschungen
mithilfe von Computerprogrammen und Datenbanken verwaltet und
unterstützt hat. Das Internet mit seinen vielen kommerziellen
und nichtkommerziellen Rechercheangeboten und die Benutzung von
Mailinglisten sind in der Mehrzahl selbstverständliche
Kommunikations- und Informationsmedien für Familienforscher.
So hat diese Besuchergruppe wenig Berührungsängste bei der Nutzung
digitaler Daten und gleichzeitig recht hohe Qualitätsansprüche
z. B. hinsichtlich Bildqualitäten, Benutzeroberflächen und Zugriffszeiten.
Woher kommen nun die digitalen Daten für die Besucher? Einen großen
Teil liefert der wichtigste Bestand des Personenstandsarchivs in
Brühl: Es ist die Sammlung von Kirchenbüchern, die sich aus
6493 Archiveinheiten aus den Jahren 1571-1874 zusammensetzt. Diese in
Deutschland einzigartige Sammlung von Kirchenbüchern und die
auch daraus resultierenden hohen Besucherzahlen haben Lokalzeitungen
das Brühler Archiv schon als "Mekka der Ahnenforscher" bezeichnen lassen.
Aus Gründen der Bestandserhaltung sind die oft sehr stark
beschädigten und aufwändig restaurierten Kirchenbücher
schon seit 1999/2000 der täglichen physischen Benutzung
entzogen. Bis in die 90er Jahre waren das gängige
Sicherungsmedium hauptsächlich Mikrofilm und Mikrofiche. Für
die Langzeitsicherung sind diese Medien auch heute noch die erste
Wahl. Für die tägliche Benutzung jedoch sind nun digitale
Bilder zum Standard geworden, da sie einfacher zu handhaben sind und
oftmals eine wesentlich bessere Lesequalität als Filme bieten.
Ende der 90er Jahre wurde in Brühl der digitale Weg beschritten
und es begann ein Sicherungsprojekt mit dem Ziel, 4196 Kirchenbücher,
die zu den ältesten Beständen gehören, durch Farbscans
digital zu sichern und den Nutzern auf diese moderne Art zur Verfügung zu stellen.
Seit Ende 2006 ist für die Scanarbeiten ein Buchscanner der Marke
Bookeye®3 A2 mit Buchwippe und Glasplatte im Einsatz.
Die Vorgaben für die Erstellung der Scans sind seit Beginn des
Projektes konstant geblieben, denn sie haben sich bewährt.
Gescannt werden Einzelseiten in Farbe mit einer Auflösung von
300dpi, im Einzelfall kann die Auflösung auf bis zu 600dpi
heraufgesetzt werden. Zieldatenformat ist jpg. Die erzielte Qualität
ist so überzeugend, dass auch penible Kunden keinen Anlass zur
Kritik finden. Allerdings sind bei den Scanarbeiten auch Profis mit
kritischem Auge am Werk. Gisela Klein und Rainer Soettke, die die
Digitalisierungsarbeiten durchführen, sind selbst ausgebildete
Fotografen, die ehemals in der Fotowerkstatt des Archivs arbeiteten.
Die Fotowerkstatt ist nun digitale Scanwerkstatt.
Die alten Kirchenbücher sind nicht selten in einem stark angegriffenen
Zustand - Zeit, unsachgemäße Aufbewahrung und häufige
Nutzung haben ihre Spuren hinterlassen bis sie schließlich
ihren Weg ins Archiv fanden und konservatorischen Maßnahmen
unterzogen werden konnten.
Tintenfraß, verblassende Schrift, eingerissene und verschmutzte Seiten,
zerbrochene Buchrücken sind die häufigsten Schädigungen.
So ist vorsichtiges aber gleichwohl zügiges Arbeiten geboten,
damit die Bücher so schnell wie möglich wieder in das
klimatisierte Magazin zurückgegeben werden können. Die
Tagesproduktion liegt inzwischen bei 600 Kirchenbuchseiten,
Paginierungsarbeiten, Qualitäts- und Vollständigkeitskontrolle inklusive.
Der Arbeitsablauf am Scangerät wird gesteuert durch die Software
BCS-2®. Mittels dieser werden die Scanaufträge
verwaltet und Bilder können nachbearbeitet werden. Einiges an
Programmierarbeit ist insbesondere in die Anforderungen zur
Seitenverwaltung geflossen. So muss für das Projekt
gewährleistet sein, dass das entstehende jpg nach der Seitenzahl
der gescannten Seite benannt wird.
Natürlich ist das kein Hexenwerk, allerdings weisen Kirchenbücher einige
Eigenwilligkeiten auf, wie z. B. beschriebene Buchdeckel, eingeklebte
Vorblätter mit Verordnungen, nachträglich eingeklebte
Korrekturzettel usw. Dies muss über verschiedene
Hierarchieebenen der Nummerierung abbildbar sein. Neben einigen
anderen Funktionen wie Seitenteilung oder Maskierung gehört es
zum Standard der Software, dass Bilder in einem
Nachbearbeitungsschritt mit erläuternden Kopf- und Fußzeilen
versehen oder auch leicht pdfs und html-Ansichten generiert werden
können. Verbessert wird die Arbeitsergonomie durch ein Scanpad
mit einer tastenbezogenen Programmierung der am häufigsten gebrauchten Funktionen.
Damit die Ablösung des zuvor eingesetzten Scannermodells durch den
Bookeye®3 auch reibungslos verlief, haben die
Mitarbeiter von ImageWare Gisela Klein und Rainer Soettke in einigen
Besuchen geschult. Durch den intensiven fachlichen Austausch, bei dem
letztlich noch Wünsche an die Software formuliert wurden, haben
beide Seiten profitiert. Die Software wurde noch leistungsfähiger
und die Arbeit der beiden Digitalisierungsprofis beschleunigt und erleichtert.
Die Archivmitarbeiter sind mit ihrem noch relativ neuen Arbeitsgerät
sehr zufrieden und trauern dem alten Scanner nicht nach: "Das
Scannen geht einfach schneller, die Qualität ist sehr gut und
einige Softwareneuerungen erleichtern uns die Nacharbeiten" ist das
Fazit von Gisela Klein und Rainer Soettke.
Mittlerweile sind ziemlich genau 50 % des Bestandes digital bearbeitet (Stand Ende
Juni 2007) und ca. 350.000 digitale Kirchenbuchseiten können von
Archivbesuchern eingesehen werden. Doch mit der Bereitstellung der
Bilddaten im Lesesaal für die Nutzer und der Langzeitspeicherung
auf dem Server - natürlich mit Sicherungskopie auf einem
zweiten Server - ließen es die Brühler nicht bewenden.
Seit Ende 2003 werden in arbeitsteiliger Kooperation mit einem eigens
gegründeten Verlag (www.ptverlag.de)
die Kirchenbücher als käufliche CD oder DVD herausgegeben.
Die Digitalisate werden dazu mittels BCS2 mit einer
html-Benutzeroberfläche versehen. Der Käufer kann sich die
Bilder als jpg oder pdf ansehen. Als zusätzliche
Informationsquellen und Erschließungshilfen enthalten die
veröffentlichten Titel Bestandsverzeichnisse und
Inhaltszusammenfassungen der jeweiligen Kirchenbücher.
Die Resonanz ist sehr positiv. Die Käufer sind begeistert von der
Qualität der Digitalisate; insbesondere erfahrene Forscher sind
froh, sich mehr und mehr bei ihren Recherchearbeiten vom Mikrofilm
verabschieden zu können. Denn die meisten Familienforscher
arbeiten am heimischen Schreibtisch, wo i.d.R. kein
Mikrofiche-Lesegerät zur Verfügung steht und
Schwarz-Weiß-Ausdrucke auf der Basis von Mikrofiches bieten oft
eine nur sehr bescheidene Qualität und bereiten dem Benutzer
dadurch Probleme beim Entziffern alter Handschriften. Ein
hochwertiges digitales Farbbild bietet dagegen oft ganz neue
Erkenntnisse bzw. hilft durch die verbesserte Lesbarkeit die eine
oder andere Forschungslücke zu schließen. Die Benutzung
wird auch durch die inhaltliche Erschließung der Kirchenbücher erleichtert.
Die Veröffentlichungsreihe mit Namen Edition Brühl ist
mittlerweile auf 136 Titel angewachsen. Monatlich kommen einige Titel
hinzu. Käufer dieser CDs kennen das Archiv oft von eigenen
Besuchen, haben aber meistens weder räumlich noch zeitlich die
Möglichkeit, das Archiv häufig zu besuchen. Daher wird die
Möglichkeit, eine Forschungshilfe zu erwerben, die ein
unabhängiges Arbeiten vom Archivstandort ermöglicht, sehr geschätzt.
Die Digitalisierungsarbeiten mit dem Bookeye3 für das
Kirchenbuchprojekt werden voraussichtlich noch bis 2012 andauern.
Bislang ist dieses Projekt aufgrund seiner Kontinuität und
seiner stetig wachsenden und qualitativ hochwertigen
Arbeitsergebnisse ein Leuchtturmprojekt in der staatlichen deutschen Archivlandschaft.

Zur Autorin
Astrid Großgarten
ImageWare Components GmbH
Am Hofgarten 20
D-53113 Bonn
E-Mail: grossgarten@ptverlag.de
 Blick auf den Seitenflügel des kurfürstlichen Schlosses, der den
Lesesaal des Archivs beherbergt.
Blick auf den Seitenflügel des kurfürstlichen Schlosses, der den
Lesesaal des Archivs beherbergt.
 Blick in den Lesesaal mit Computer- und Mikrofiche- Arbeitsplätzen
Blick in den Lesesaal mit Computer- und Mikrofiche- Arbeitsplätzen
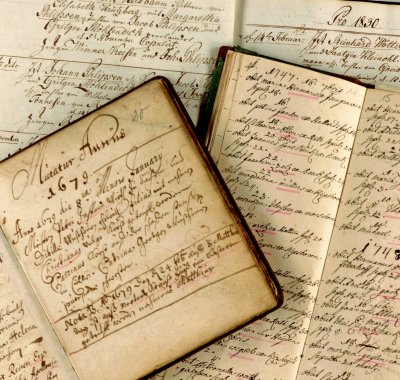 Einige Archivalien zur Ansicht: Kirchenbücher des 17.- 19.
Jahrhunderts (LAV NRW PSA Brühl BA 89 Bachem, BA 101 Baerl, BA 137 Beeck)
Einige Archivalien zur Ansicht: Kirchenbücher des 17.- 19.
Jahrhunderts (LAV NRW PSA Brühl BA 89 Bachem, BA 101 Baerl, BA 137 Beeck)
 Gisela Klein bei der Scanarbeit
Gisela Klein bei der Scanarbeit
