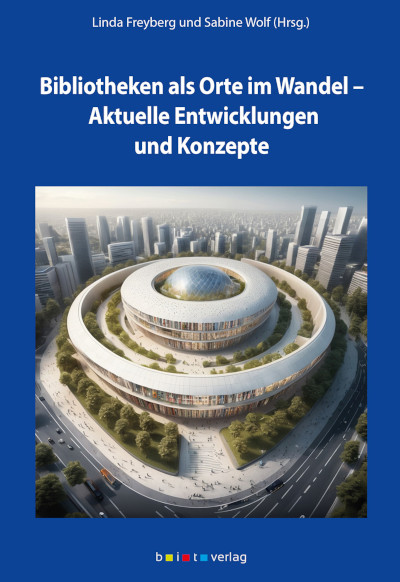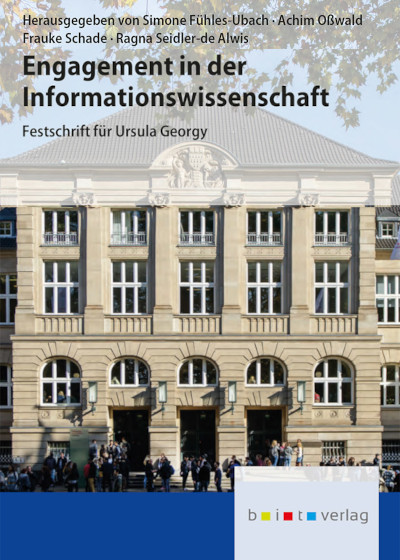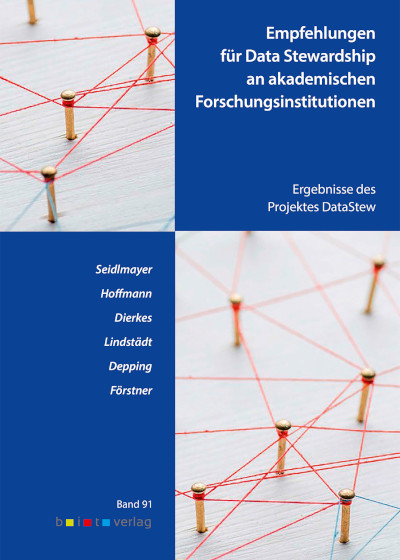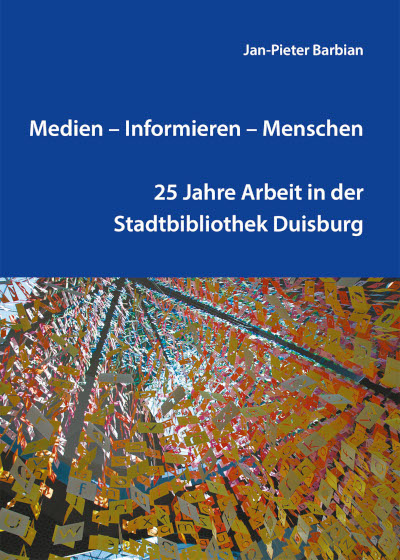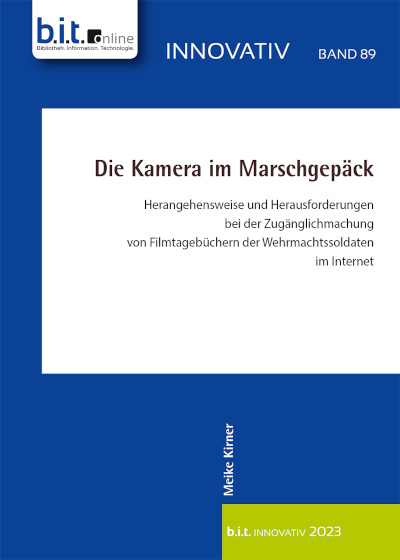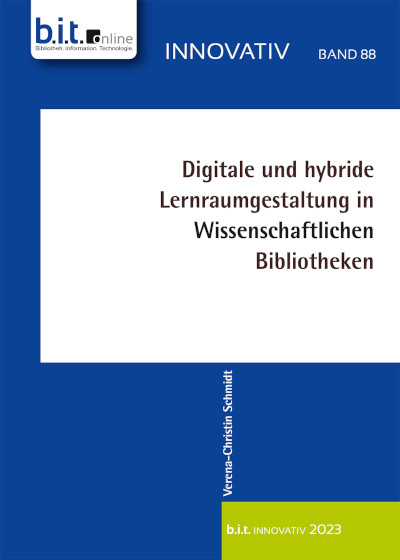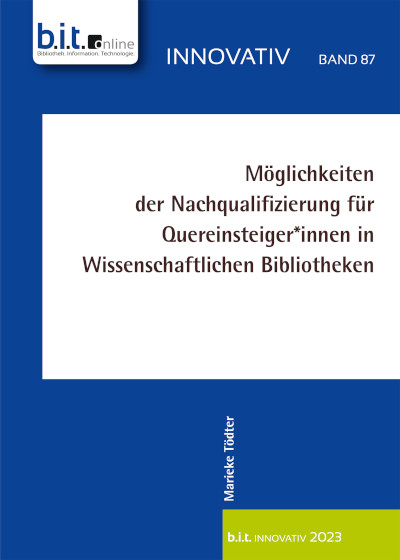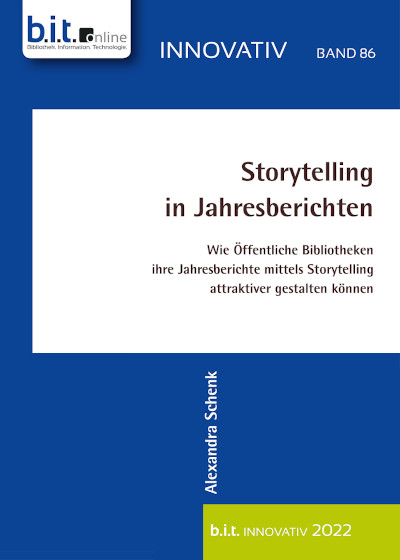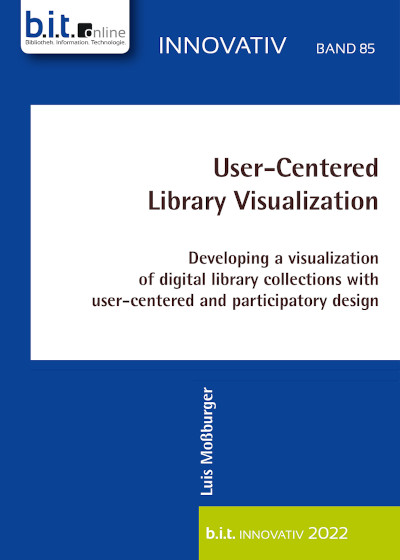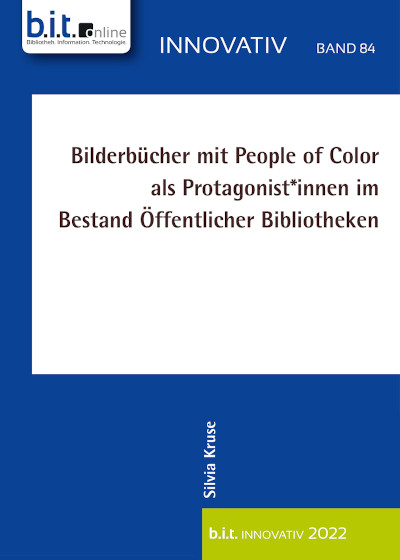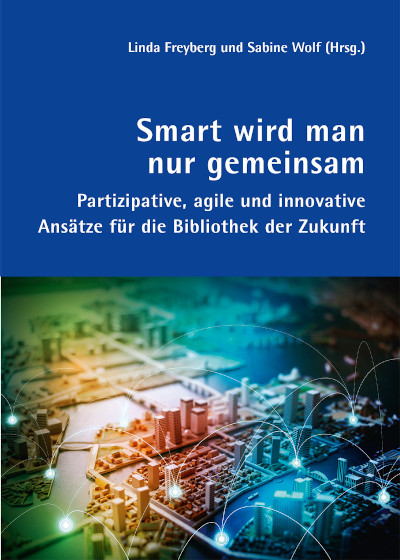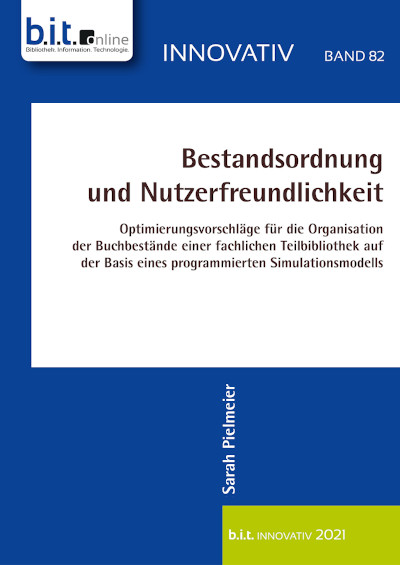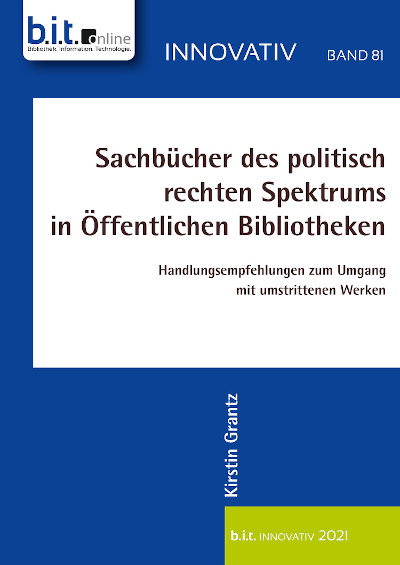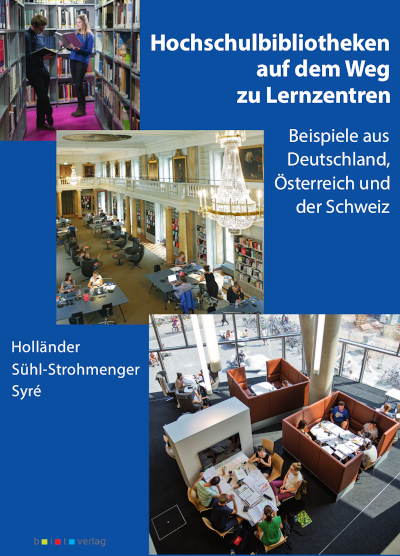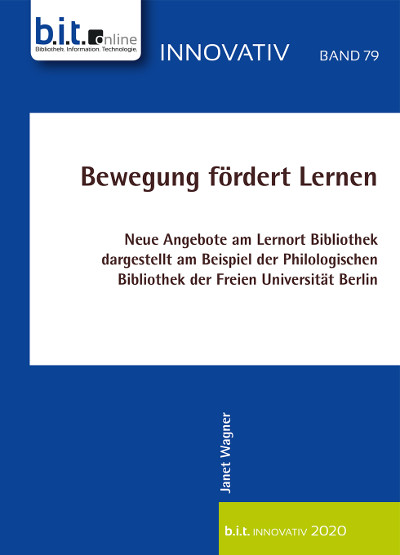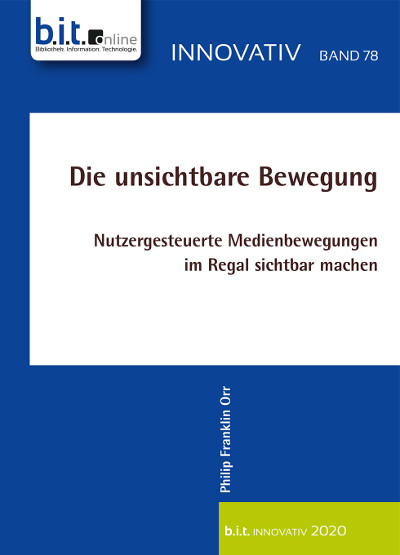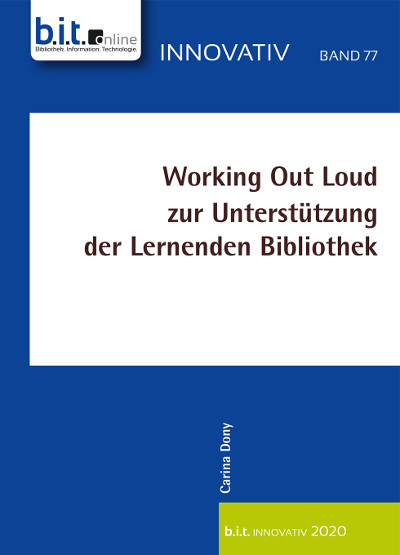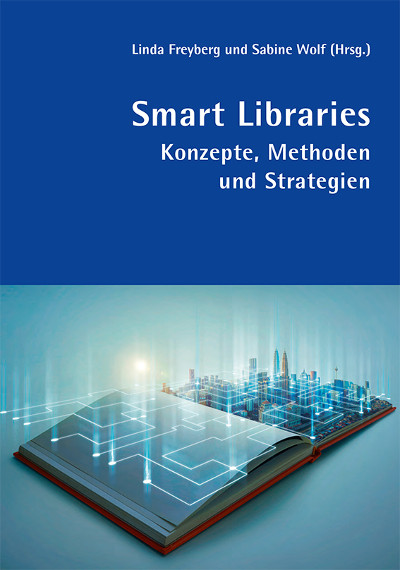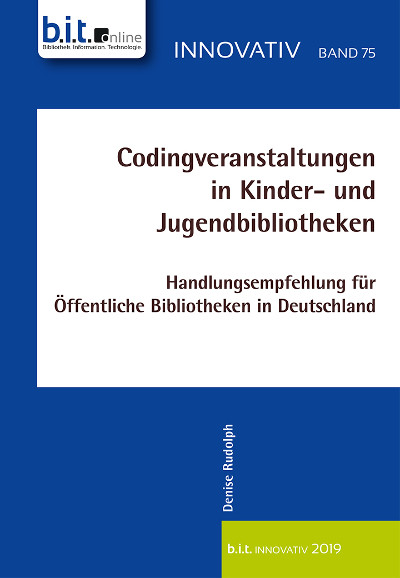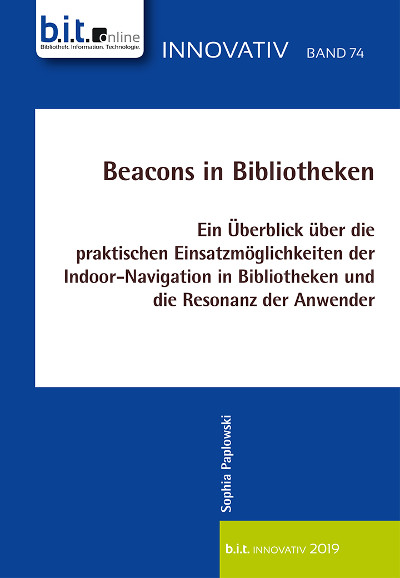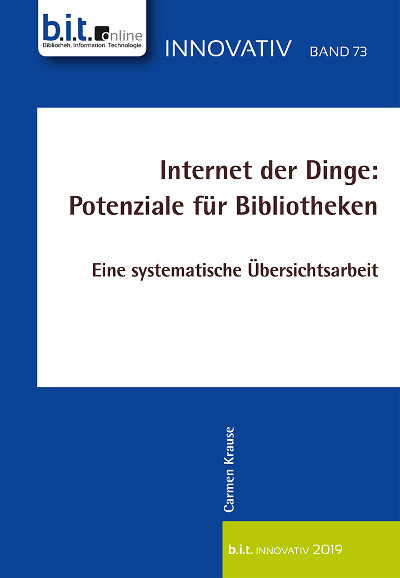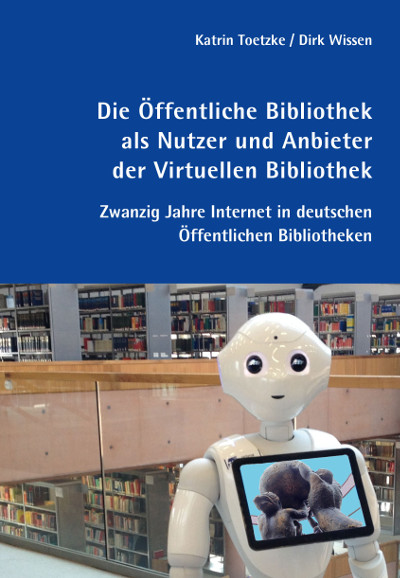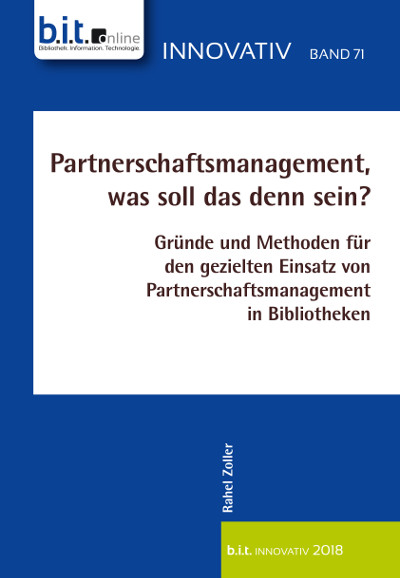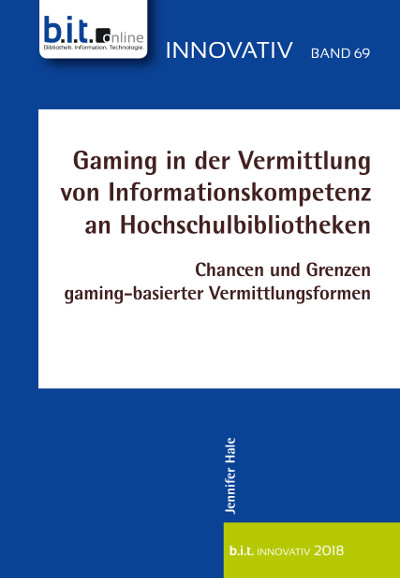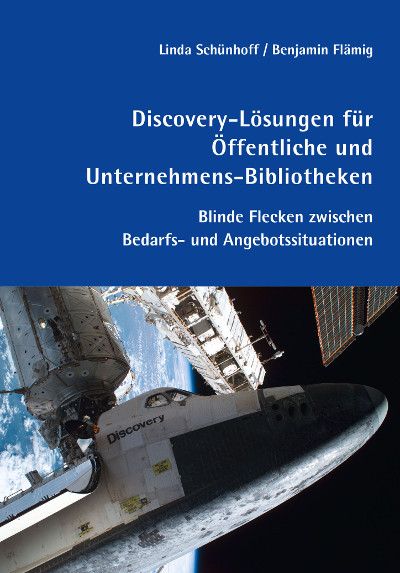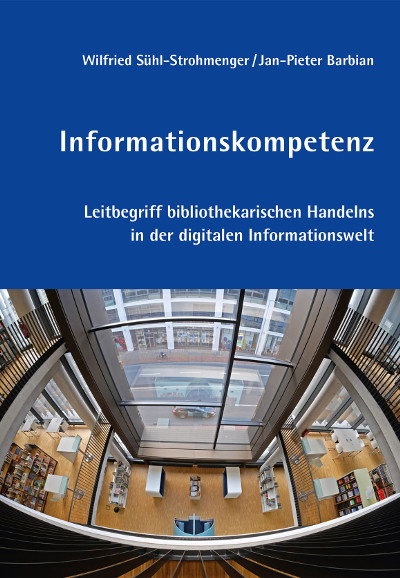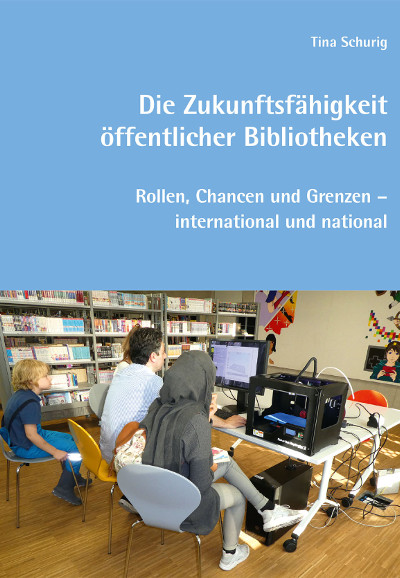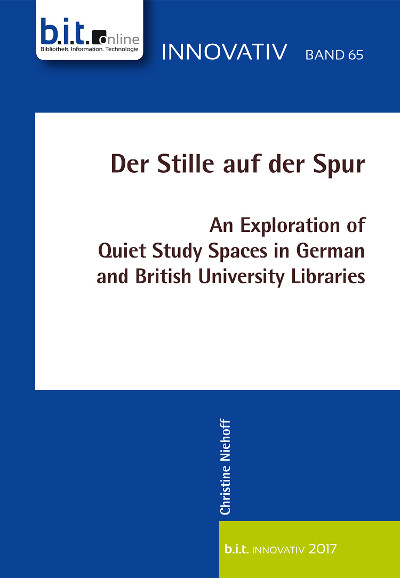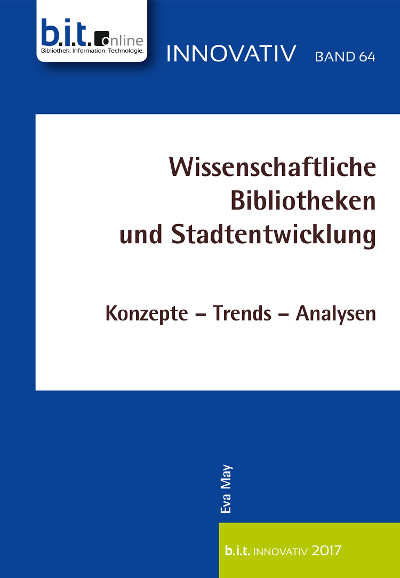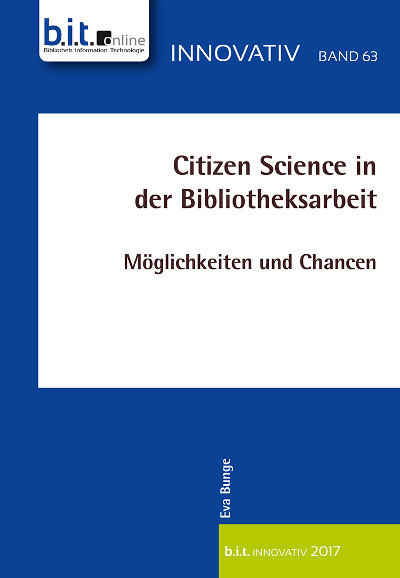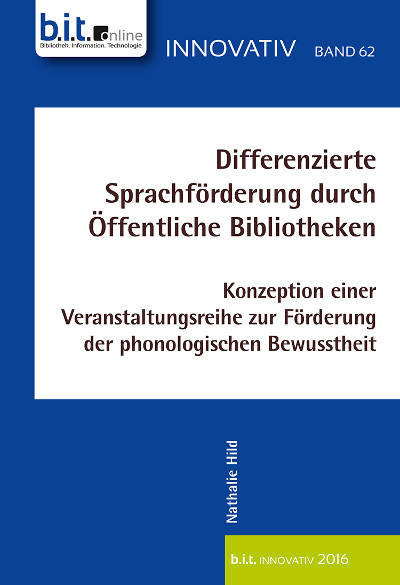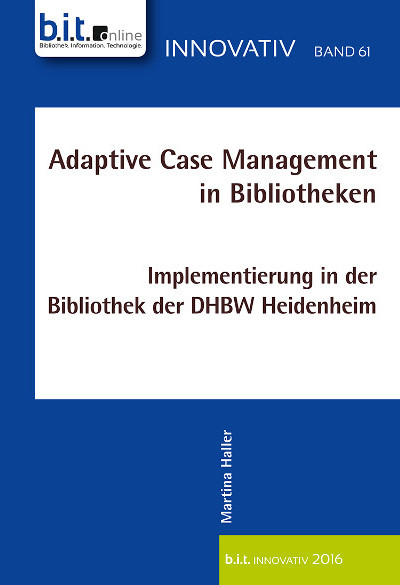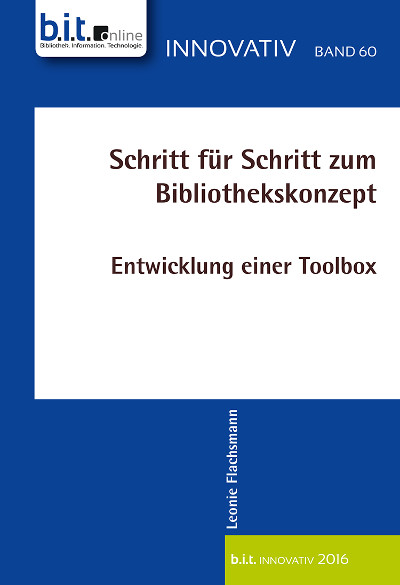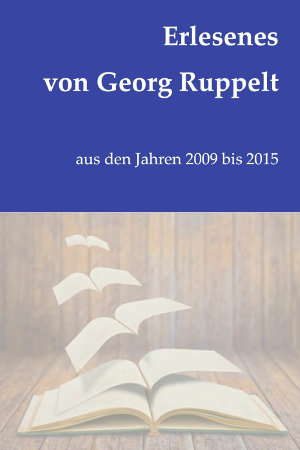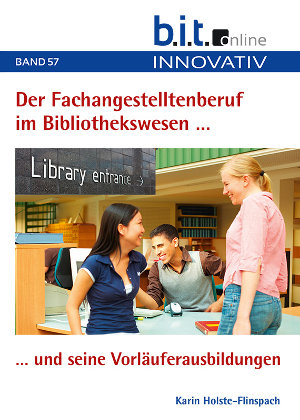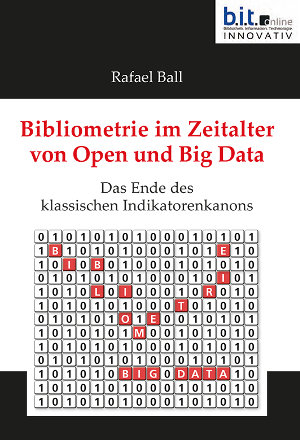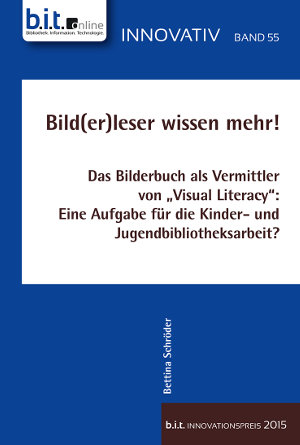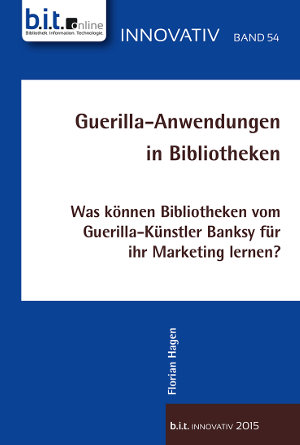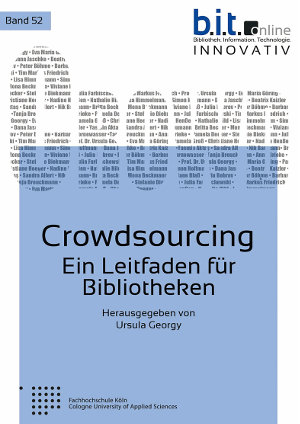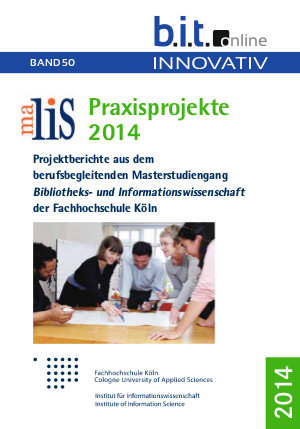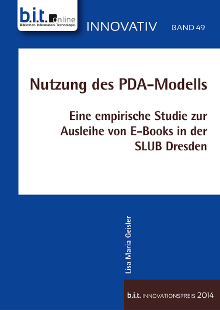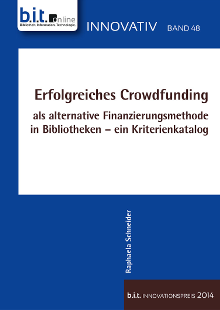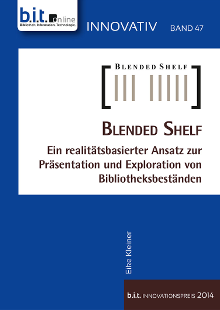b.i.t.online 1 / 2015 Fachbeiträge
Lernraum-Management – Eine Aufgabe für Bibliotheken

Friederike Hoebel, Michael W. Mönnich
War Mitte der 1990er Jahre unter dem Eindruck von Internet und elektronischem Publizieren die Ver-
ödung von Bibliotheken prognostiziert, so sind diese heute entgegen der Voraussagen so gut besucht wie
nie zuvor. Die technischen Herausforderungen haben die Institutionen dabei still gemeistert und flexibel
auf den Wandel des Informationsangebotes und die technischen Möglichkeiten reagiert. Tatsächlich hat
sich bewährt, mit neuen Informationsformen ähnlich zu verfahren, wie es bibliothekarischer Praxis schon
lange entspricht: Publizierte Informationen werden gesammelt, geordnet und für Nutzer verfügbar gemacht1
, geändert haben sich allein die Formate und die Hilfsmittel. Der Bezeichnung „Hybride Bibliothek“
bedarf es inzwischen kaum mehr, da diese hybride Bereitstellung unterschiedlicher Informationsgenres
zur Selbstverständlichkeit geworden ist. Anschlüsse für Strom- und Datenleitungen und ein leistungsfähiges
WLAN gehören inzwischen zur Standardausstattung von Lesesaalplätzen und werden von studentischen
Nutzern als selbstverständlich vorausgesetzt. Die Nutzung der Bibliotheksräume hat sich also nicht
nur in quantitativer sondern auch in qualitativer Hinsicht verändert. Bei ihren Nutzern erfreuen sich daher
Bibliotheken in der räumlichen Nähe zu Hochschulen größter Beliebtheit.
Kataloganreicherung durch Social Cataloging: Lohnt sich das?

Evaluation des Einsatzes von LibraryThing for Libraries
zur Anreicherung der Kataloge von 24 Öffentlichen Bibliotheken
Simone Fühles-Ubach, Miriam Albers und Simon Brenner
Die Funktion von Katalogen im Allgemeinen und denen von Bibliotheken im Speziellen war und ist der
Nachweis des jeweiligen Bestandes. Die häufig erste Suchanfrage der Kunden, auch bei großen Internetbuchhandlungen, ist: „Haben die das?“ Durch sog. Kataloganreicherungen mit z.B. zusätzlichen Produktinformationen, statistischen Analysen von Nutzungsdaten oder „sozialen“ Beteiligungsmöglichkeiten haben
sich jedoch die lösbaren Fragestellungen bei der Suche in kommerziellen Online-Katalogen stark erweitert.
Auch die Suche nach einem Buch für ein Kind unter zwei Jahren oder die Frage, was einem gefallen
könnte, wenn man zuletzt Roman xy gelesen hat, wird selbstverständlich in wenigen Sekunden zufriedenstellend
bedient. Warum sind diese Funktionen dann nicht auch in Bibliotheken bereits selbstverständlich? Sind solche Erweiterungen im bibliothekarischen Kontext etwa nicht zweckmäßig, überflüssig oder werden nicht nachgefragt?