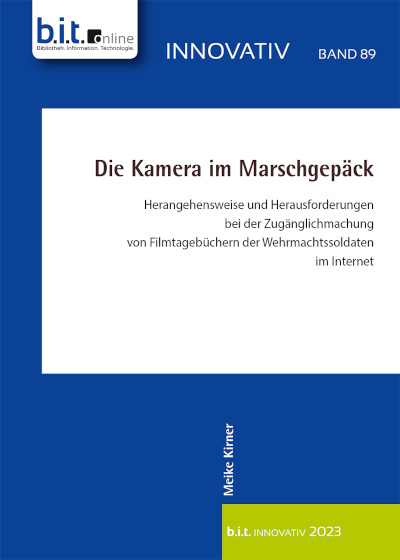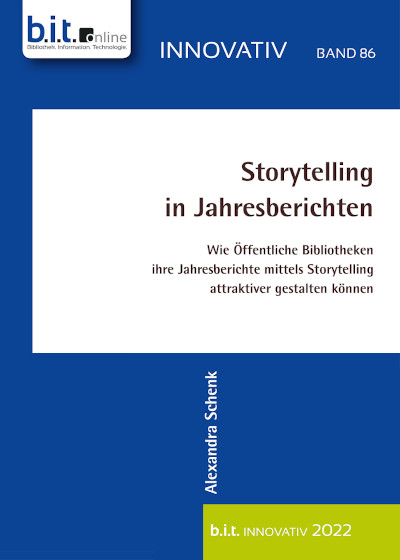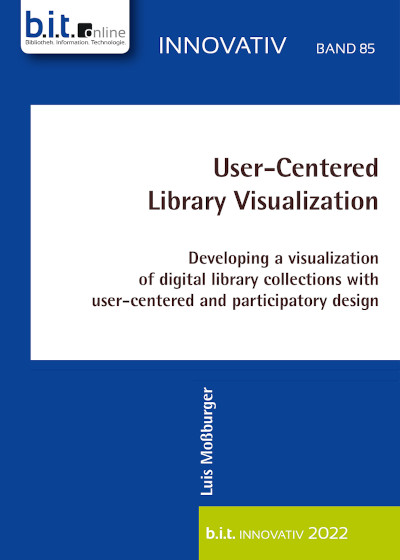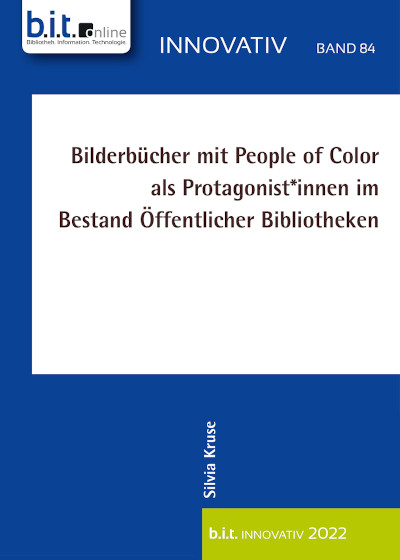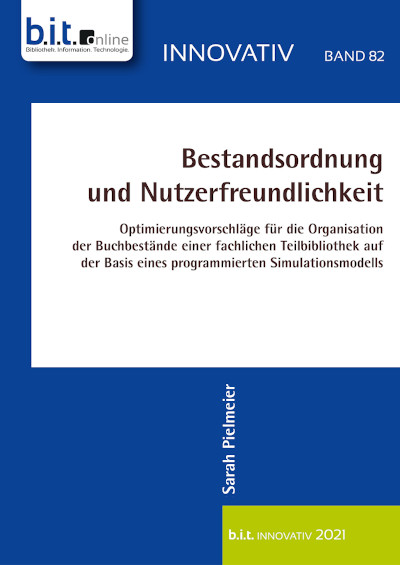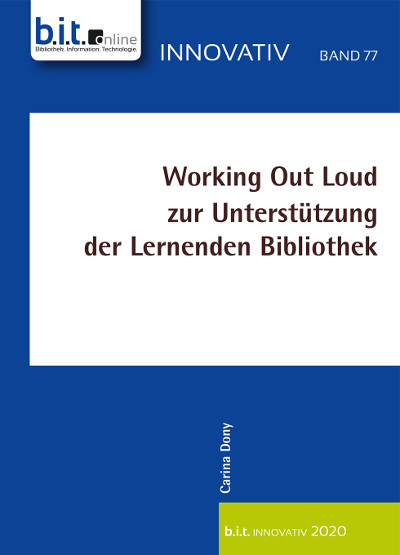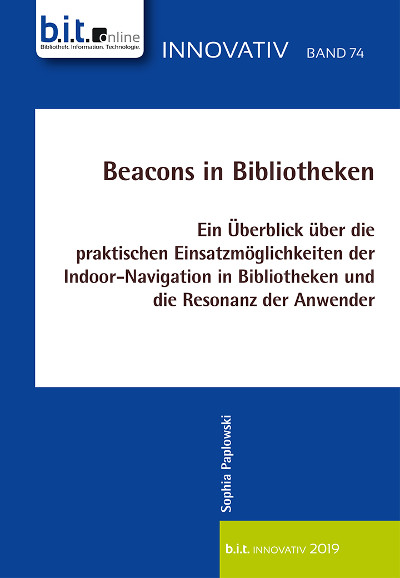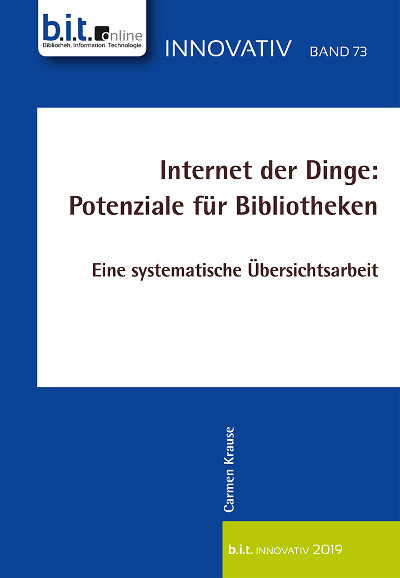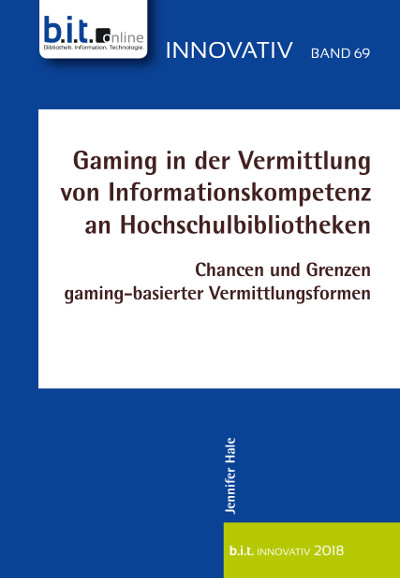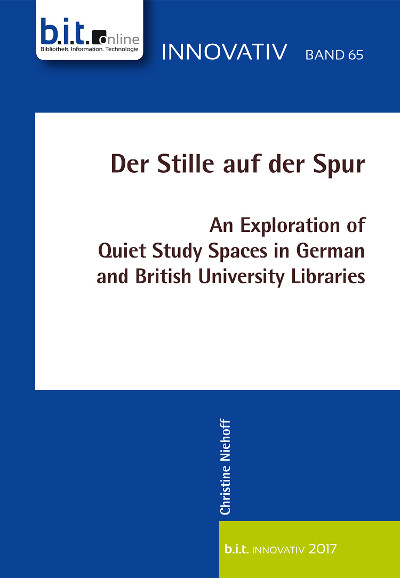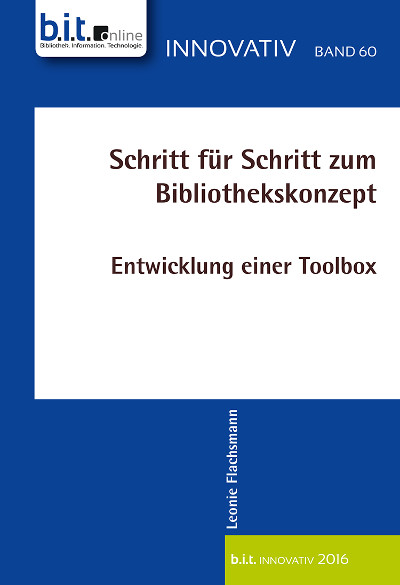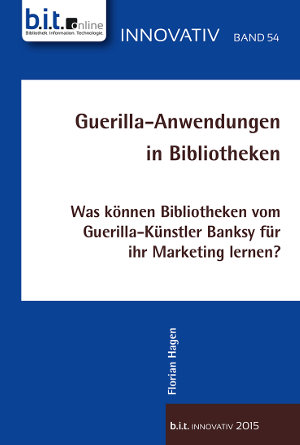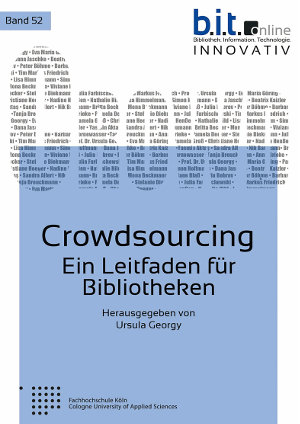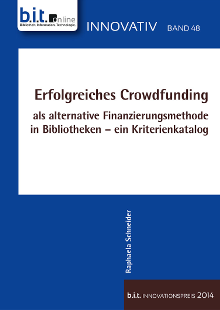Home oder Office?
Prof. Dr. Andreas Degkwitz
In Zeiten, wie wir sie aktuell erleben, soll niemand klagen, wer gesund ist, eine Wohnung und genug zu essen hat. Zu bewundern sind alle diejenigen, die wie Ärztinnen und Ärzte, Krankenschwestern und Pfleger an vorderster Front im Kampf gegen die Pandemie stehen und dabei hohe Risiken für sich selbst eingehen. Bibliothekarinnen und Bibliothekare können im Kontakt mit Nutzerinnen und Nutzern in Risikosituationen geraten. Doch wenn die Bibliotheken für den Publikumsverkehr geschlossen sind oder zur Vermeidung von Infektionen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Häuser und Gebäude nicht mehr betreten dürfen, finden sich alle in ihren Home-Offices ein und bemühen sich, Aufgaben, die ihnen übertragen wurden, mit Desktop, Internet und I-Pad sowie mit Smart- und Telefon zu erledigen. Nun wird tatsächlich digital gearbeitet – ein ganz anderes, neues Erlebnis und eine Umstellung, die alle angeht. Die Bereitschaft, sich dieser Herausforderung zu stellen, steht dabei nicht in Frage, auch wenn die Geduld bisweilen stark strapaziert wird. Was mich betrifft, hatte ich allerdings bald eine Art Sehnsucht nach meinem Büro. Die folgenden Ausführungen möchte ich deshalb allein auf mich beziehen und in keiner Weise verallgemeinern. Denn ausschließen kann ich tatsächlich nicht, dass kaum jemand sein Home-Office so wenig vorbereitet in Betrieb nahm wie ich.
Eingepackt in zwei Rucksäcke hatte ich alle Akten und Wiedervorlagen der Woche in mein Daheim gebracht und wenig liebevoll auf Stühle und Tische meiner Home-Office-Umgebung ausgelegt. Dass ich am Tag drauf mit der Videokonferenz meine Abteilungsleiter/-innen zu Zeugen dieses Chaos machte, hatte ich dabei nicht bedacht. Auch dass sich jede Einsicht in papiergebundene Unterlagen als Illusion erwies, wurde mir klar, als ich mich außerstande sah, Akten während Videokonferenzen einzusehen, ohne mich dabei vollkommen lächerlich zu machen. Der erste Tag in meinem Home-Office fing allerdings ganz anders an. Wie ich es immer tat, wenn ich Home-Office praktizierte, loggte ich mich zunächst auf der gemeinsamen Arbeitsplattform aller UB-Mitarbeiter/-innen ein. Denn für die Videokonferenz mit den Abteilungsleiter/-innen stand die Planung aller Onlinedienste an, die bei Schließung der UB Nutzerinnen und Nutzern zur Verfügung gestellt werden sollten. Doch der Zugang zu der Plattform erwies sich wider Erwarten als unmöglich. Offenbar war ich nicht der einzige, der sich damit plagte. Denn nach drei Versuchen erreichte mich eine Mail auf mein Smartphone, dass die Plattform leider ausgefallen und bis auf weiteres nicht erreichbar sei. Die Planungsunterlage befinde sich nun in einer Cloud und könne dort diskutiert werden. Nicht dass ich noch nie in einer Cloud gearbeitet hätte, doch die Cloud, die nun die Planung barg, war mir bis dato unbekannt. In dieser Cloud nun „Word“ zu nutzen oder mit Excel-Tabellen zu kollaborieren, überforderte mich. Allerdings konnte ich die Planungsunterlage immerhin lesen, so dass wir darüber diskutieren konnten.
Zur nächsten Überraschung kam es, als die Videokonferenz begann. Als ich mich selbst auf dem Bildschirm sah, stellte ich fest, dass mein Kopf nur zur Hälfte erkennbar war und sich die Kamera von unten und nur zur Hälfte auf mein Gesicht richtete. Ich versuchte, die Kamera anders zu positionieren, aber Pardon, das wollte sie offenbar nicht und funktionierte nicht mehr. Mein Laptop, der schon in die Jahre gekommen ist, schwächelte offensichtlich bereits, bevor die Home-Office-Phase überhaupt richtig begonnen hatte. Vorteilhaft war, dass die Unordnung, die mich umgab, nun nicht mehr vor die Augen meiner Abteilungsleiter/-innen trat. Doch plagte mich nun die Frage, woher sich jetzt ein neuer Laptop für mich beschaffen ließ. Vor der nächsten Konferenz, die zum Glück rein telefonisch verlaufen sollte, befasste ich mich mit der Cloud, in der die Planung zu den Onlinediensten gespeichert war. Nach ein paar „Spielversuchen“ hatte ich verstanden, wie „Office“ sich darin nutzen ließ und atmete durchaus stolz und zufrieden auf. So ganz blöd sei ich eben doch nicht, sagte ich mir. Aber die nächste Enttäuschung wartete schon. Mein Festnetz-Telefon, das ich für die Telko nutzte, war nach einer Stunde zu meinem Bedauern platt. Die Konferenz brach plötzlich und unversehens für mich ab. Die Batterien des Handgeräts waren komplett erledigt.
In meinem Home-Office folgte ganz offensichtlich ein Problem auf das andere. Denn als ich – darüber sehr verzweifelt – nun meine Mails, die in mein Postfach fluteten, einsehen wollte, brauchte der Seitenaufbau der Eingangspost zu meinem Ärger zwei Minuten und länger. Leider war es mit den Antwortmails noch viel schlimmer. Diese entnervende Bearbeitung digitaler Kommunikation gab ich auf und verschob sie auf die Mittagspause. Dann war das Netz hoffentlich nicht mehr so stark belastet. Insgesamt wurde mir bei diesen Misslichkeiten klar, dass ich mit meinem Home-Office schnell ans Ende komme, wenn ich meine Arbeit dort so schnell zu erledigen glaubte wie im Büro. Eine komplette Transformation ins Digitale setzt offenbar deutlich mehr voraus, als ich es bisher für möglich hielt. Dass immer wieder etwas anderes schief ging, sorgte bei mir für großen Verdruss. Doch zu meiner großen Freude habe ich mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein in der Tat super Team. Von daher bin ich mir sicher, dass wir die vielen Herausforderungen, die sich uns jetzt und künftig stellen, erfolgreich stemmen, wenn wir als Team agieren. Diese Erfahrung ist wirklich bereichernd. Allen Beteiligten danke ich sehr dafür. Offensichtlich setzt digitale Transformation auf Team- und Zusammenarbeit. Mögen alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Teams, die unsere Bibliotheken – landauf und landab – innovativ und stark machen, bitte alle gesund an Bord bleiben!

Prof. Dr. Andreas Degkwitz
Direktor der Universitätsbibliothek
der Humboldt-Universität zu Berlin
und Honorarprofessor im Fachbereich Informationswissenschaften
der Fachhochschule Potsdam
andreas.degkwitz@ub.hu-berlin.de