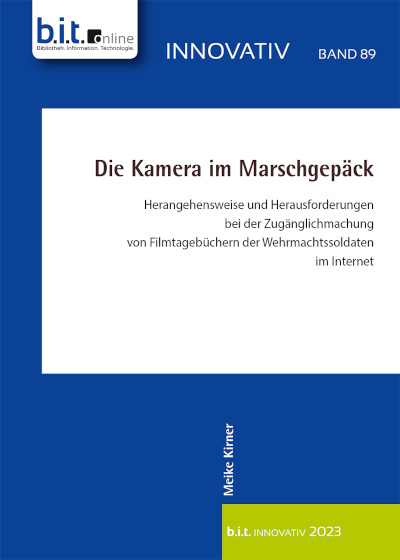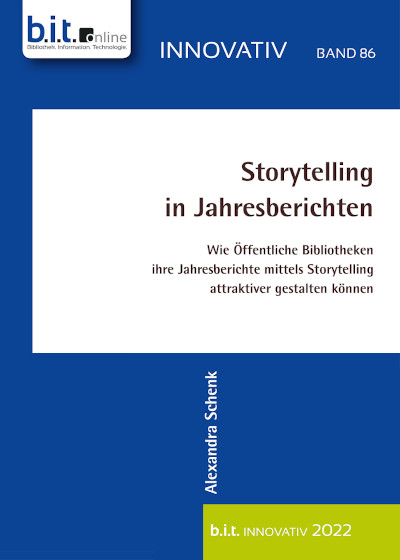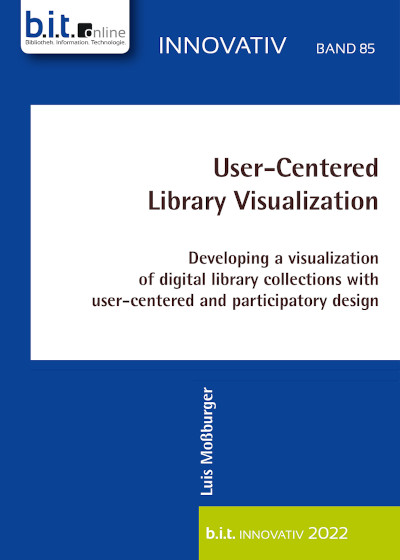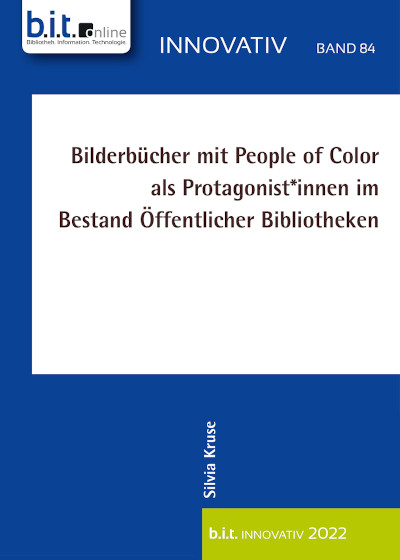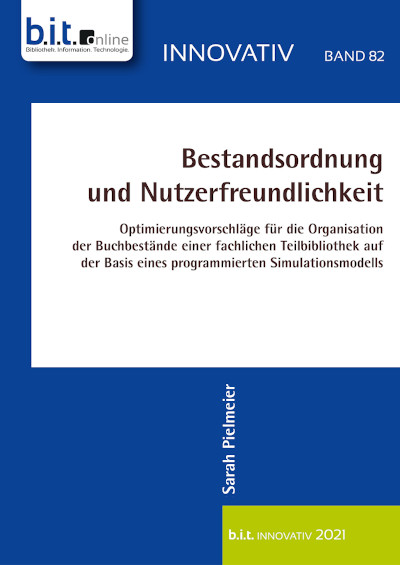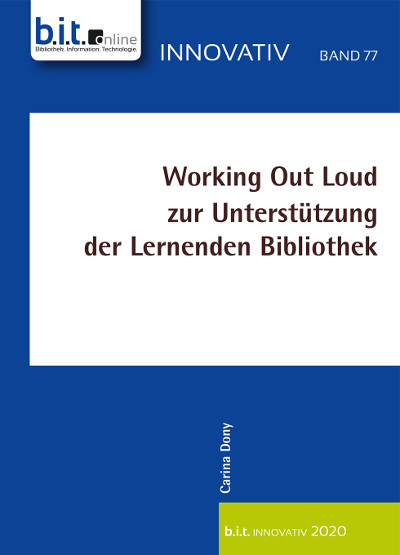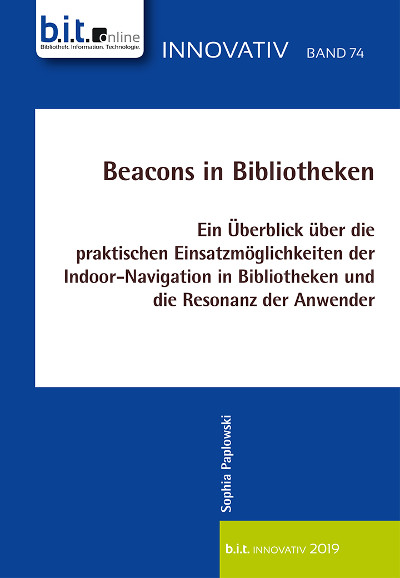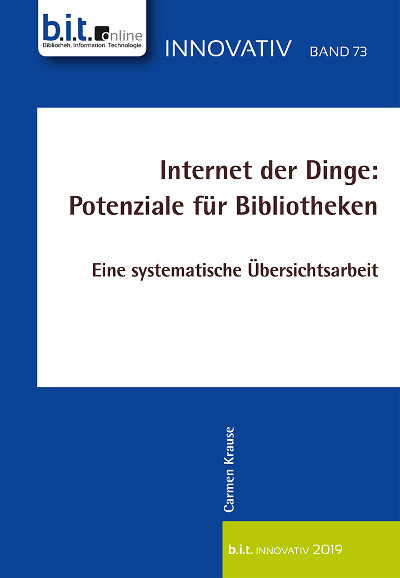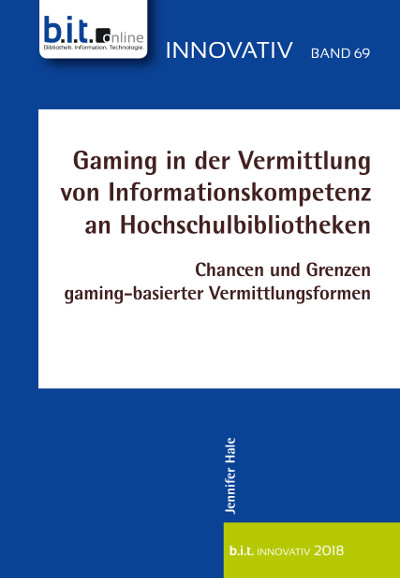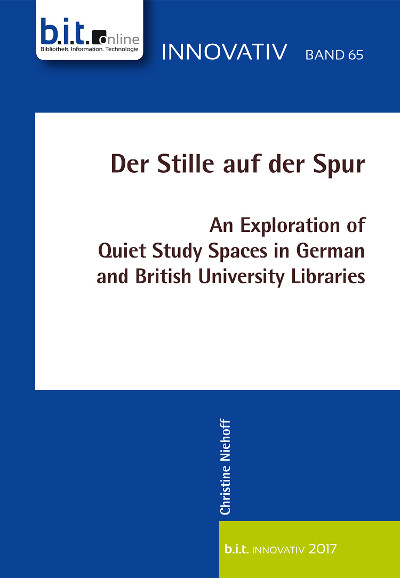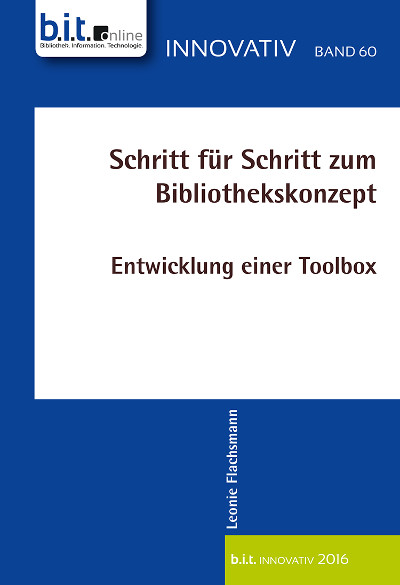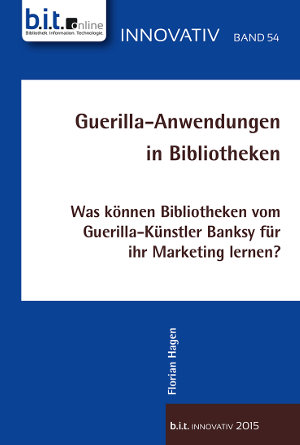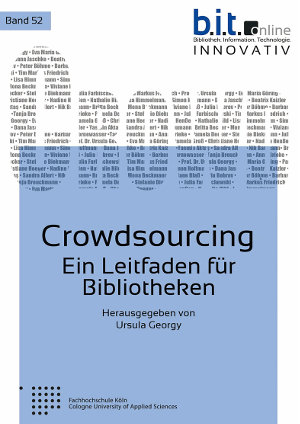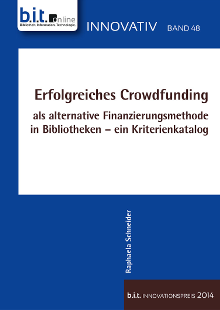Ein Krisentagebuch
Dr. Klaus-Rainer Brintzinger
Anfang März:
Die Medien berichten über die Ausbreitung von Corona in China und Italien, die Arbeit bei uns geht normal weiter. Ich plane die Sitzung der Sektion 4 Ende April, plane für den Bibliothekartag im Mai, plane Besprechungen und Einladungen von Kollegen im März und April. Erste Anfragen kommen, ob Veranstaltungen wegen Corona ausfallen könnten. Perfekte Sicherheit gibt es nie, denke ich. So war im Februar die Sitzung des Hauptausschusses der Sektion 4 dem recht harmlosen Sturm „Sabine“ zum Opfer gefallen – auch dies war nicht vorhersehbar. Ich wundere mich über die schlechten Nerven mancher Kollegen.
An der Uni gibt es nun erste Verhaltensregeln: Rückkehrer aus Risikogebieten dürfen 14 Tage lang nicht mehr zur Arbeit kommen. Risikogebiete sind bisher neben China und Südkorea nur zwei italienische Regionen, dies betrifft bei uns niemanden.
Im Laufe der Woche werden auch erste bibliothekarische Veranstaltungen abgesagt. Besonders vorsichtige Kollegen fragen an, ob sie ihre Bibliotheken prophylaktisch schließen sollen. Ich plane dagegen weiter und gewinne noch Vortragende für die Sitzung der Sektion 4. Ich richte mich nach der Devise des großen Münchner Hygienikers Max von Pettenkofer, der während der Cholera-Epidemie 1854 gesagt haben soll, keine Epidemie könne so groß sein, dass es gerechtfertigt sei, den bürgerlichen Verkehr einzustellen.
Sonntag, 8. März:
Nun ist auch Südtirol Risikogebiet. Halb Bayern war in den Faschingsferien dort zum Skifahren. Noch am Wochenende stelle ich gemäß den Richtlinien unserer Universität erste Kolleginnen und Kollegen frei, die allerdings nach ihrer Rückkehr noch eine ganze Woche bei der Arbeit waren.
Donnerstag, 12. März:
Theater sind nun geschlossen, immer mehr Veranstaltungen werden abgesagt. Am Abend sickert durch, dass Söder in Bayern die Schulen schließen lassen wolle.
Freitag, 13. März:
Den ersten Termin am Morgen verschiebe ich, um die Pressekonferenz zu sehen: Alle Schulen werden geschlossen, Kinder müssen zuhause betreut werden; arbeitet ein Elternteil in einem systemrelevanten Bereich, muss der andere zuhause bleiben. Dies könnte auf mich zutreffen. Meine Frau ist Fachpflegekraft für Intensivpflege und Anästhesie. Sie ist systemrelevant, ich nicht – dies ist mir gleich klar; dennoch wird die Bibliothek gerade in der Krise eine Leitung brauchen.
Für die Mittagszeit berufe ich eine Krisensitzung der Abteilungsleitungen ein. Vorher frage ich bei der Hochschulleitung nach, ob etwas über mögliche Bibliotheksschließungen bekannt ist – doch vom Ministerium liegt überhaupt noch nichts vor. Mit den Abteilungsleitungen gehen wir alle Szenarien durch: Schließung der Präsenznutzung – mit oder ohne Schließung der Ausleihe? Soll die Fernleihe weiterlaufen und der Campuslieferdienst? Als wir mit den Planungen durch sind, kommt die Pressemeldung des Ministeriums: Alle Bibliotheken müssen ab Samstag schließen. Wir sind vorbereitet und können den Betrieb und alle Systeme geordnet herunterfahren, die Ausleihmöglichkeit deaktivieren, den Mahnlauf aussetzen und unsere Nutzer informieren. Am Abend kommt dann das Schreiben des Ministeriums an. Demnach sollten nur die Lesesäle geschlossen werden, die Ausleihe aber weiterhin möglich sein. Ich beschließe in eigener Verantwortung: Was geschlossen ist, bleibt geschlossen.
Sonntag, 15. März:
Die Hochschulleitung lädt zu einer Krisensitzung für Montagmittag ein.
Montag, 16. März:
Mittags Krisensitzung. Ergebnis: Am nächsten Tag wird die ganze Universität für den Publikumsverkehr geschlossen – alle Eingänge werden abgesperrt. Basis-Servicedienste sollen aufrechterhalten werden, dafür ist auch Anwesenheit vor Ort erforderlich, ansonsten solle möglichst im Homeoffice gearbeitet werden. Beides ist nicht einfach: Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort müssen erst Schließrechte für die Gebäude beantragt und umgesetzt werden – mit Homeoffice haben wir zwar bei einem sehr kleinen Teil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereits Erfahrung, aber nicht jedes Aufgabenprofil lässt sich im Homeoffice umsetzen, schon gar nicht mit einem Vorlauf von weniger als 24 Stunden. Mit einer gewissen Vorahnung hatten wir schon Anfang des Monats zusätzliche Notebooks bestellt – aber der Lieferant hatte uns Lieferschwierigkeiten zurückgemeldet.
Am Abend schreibe ich Richtlinien für das Arbeiten im Homeoffice: in welchen Fällen für Kinderbetreuung freigestellt werden kann, wie mit bereits gewährtem Urlaub umzugehen ist. Vieles davon ist am nächsten Tag schon wieder überholt. Nicht alles, was an ministeriellen Regelungen hereinkommt, ist konsistent und widerspruchsfrei.
Mittwoch, 18. März:
Ich arbeite weiterhin von meinem Büro aus. Termine nehme ich nur noch telefonisch wahr. Für unsere Besprechungsrunden richten wir Videokonferenzen ein. Meine Erfahrung mit Videokonferenzen ergab schon in Nicht-Krisenzeiten: Mindestens ein Teilnehmer kann sich nicht einwählen, einer kann nichts hören, einer kann nicht sprechen. Nun kommt noch die Überlastung der Netze hinzu. Manches muss hinterher per Mail nochmals zusammengefasst oder es muss nachtelefoniert werden – dies kostet viel Zeit. In der Runde der Abteilungsleitungen, für die wir ein Ad-hoc-Krisengremium eingerichtet haben, legen wir systemkritische Dienste für unsere Bibliothek fest: Die elektronischen Dienste wollen wir unbedingt aufrechterhalten und ad hoc weiter ausbauen, auch den Campus-Lieferdienst wollen wir weiter betreiben; unsere ub.information soll immer per Telefon und Mail erreichbar sein. Dazu kommen die notwendigen Infrastrukturdienste, vor allem Post- und Fahrdienst, Verwaltung und Leitung. Bei knapp 20 Standorten erfordert dies eine beträchtliche Logistik.
Freitag, 20. März:
Während ich koordiniere, wer vor Ort und wer von zuhause aus arbeiten wird, kommt die Meldung, der Ministerpräsident habe nun Ausgangssperren verhängt. Ich verzichte darauf, mir die Pressekonferenz anzusehen, lese aber den Text nach: Arbeiten ist auch außer Haus weiterhin in vollem Umfang erlaubt, im Park auf einer Bank zu sitzen dagegen wohl nicht. In der Krise sollte man besser nicht über den Sinn der Maßnahmen nachdenken. Einige meiner engeren Mitarbeiterinnen bitten mich um Passierscheine, die ich auf Briefpapier mit Siegel und Unterschrift ausstelle. Doch unsere Universität hat vorgesorgt: Bereits am Samstag wird allen Unibediensteten im Intranet eine Arbeitsbescheinigung hinterlegt. „Diese Bescheinigung ist ohne Unterschrift gültig“, ist darauf zu lesen.
Samstag, 21. März:
Durch München fahren Lautsprecherwagen. Ein Endlosband auf Deutsch und Englisch verkündet, dass bei unberechtigtem Verlassen der Wohnung strengste Strafen drohten. Ich denke kurz darüber nach, ob es bei diesem Szenario überhaupt noch sinnvoll ist, bibliothekarische Services anzubieten.
Montag, 23. März:
Vor Ort in der Bibliothek sind nur noch wenige Kolleginnen und Kollegen; diejenigen, die hier sind, sind auf angenehme Weise unaufgeregt. Für betriebswichtige Bereiche richten wir einen Zwei-Schichten-Betrieb ein, damit wir beim Ausfall einer Schicht weiter arbeitsfähig bleiben. Mit meinem Stellvertreter vereinbare ich, dass wir für die nächste Zeit jeden persönlichen Kontakt vermeiden.
Kolleginnen und Kollegen, die zuhause Kinder betreuen, sind freigestellt, wenn auch „subsidiär“, was immer das in diesem Zusammenhang bedeutet. Ich persönlich entscheide mich für ein anderes Modell: Durch die Schulschließung kommt meine Tochter in ihren natürlichen Biorhythmus – etwas, auf das der Münchner Schlafforscher Till Roenneberg seit langem hinweist: Wir machen, wenn ich nach Hause komme, Matheaufgaben bis in den späten Abend – das klappt ganz gut!
Meine Frau, die sich nun auf die intensivmedizinische Behandlung der schwer Covid-19-Erkrankten einstellen soll, bekommt im Übrigen von ihrer Klinik eine ganz andere Botschaft übermittelt: Die Zeit, in der die Klinik wegen der Absage der Regel-OPs weitgehend leer steht, gelte als unbezahlte Freizeit und müsse nachgearbeitet werden. Zur höheren Motivation wird auch gleich angekündigt, dass die Auszahlung des April-Gehaltes nicht garantiert werden könne. So schafft man Pflegenotstand, der nun Menschenleben kosten kann, denke ich – und: Wie gut es uns doch in unseren Jobs in Bibliotheken und der Universität geht und wie wenig Existentielles von uns gefordert wird. Eine Kollegin schrieb mir, bevor sie ihre Bibliothek abschloss, wir seien doch nicht „kriegsentscheidend“ – dies ist wohl wahr. Dafür sind wir aber erstaunlich gut abgesichert und klagen oft auf hohem Niveau. Ich denke dabei an die Buchhändler, Messebauer oder die freien Künstler, von denen viele jetzt schon vor dem Nichts stehen.
Ich merke, dass ich nun oft sehr barsch reagiere: Wenn angefragt wird, ob die Sektion 4 oder der Bibliothekartag stattfinde – man müsse dies rasch wissen, weil das Stornieren von Bahn und Hotel doch so aufwändig sei; oder weil man nicht vergeblich einen Vortrag vorbereiten wolle. Oder: Man möge rasch mitteilen, wann die Bibliothek wieder geöffnet sei, weil Beamtenanwärter ihr Pflichtpraktikum termingerecht aufnehmen müssten. Auch privat bekomme ich merkwürdige Anfragen, z. B. von einem aufgeblasenen Hausverwalter, für den es nichts Wichtigeres zu geben scheint, als das termin- und formgerechte Abhalten einer Hauseigentümerversammlung.
Freitag, 27. März:
Einzelne Fakultäten und Professoren drängen, die geschlossenen Bibliotheken benutzen zu dürfen, das Ministerium habe mitgeteilt, dass am vorgesehenen Semesterbeginn festgehalten werden solle. Mir leuchtet ein, dass Wissenschaftler sich auf Lehrveranstaltungen vorbereiten müssen, die Schließung der Bibliotheken ist jedoch vom Ministerium verordnet worden und wir können diese Regelung schlecht unterlaufen, während gleichzeitig Einheiten der Bereitschaftspolizei den Englischen Garten durchkämmen, um Verstöße gegen die Ausgangsbeschränkungen zu unterbinden. Wir denken daher über einen Buchlieferdienst nach. Für eine sinnvolle Planung müsste man jedoch den Zeithorizont kennen. Sollen wir uns nun auf vier, acht oder zwölf Wochen Bibliotheksschließung einstellen?
Montag, 30. März:
Ich sage nun die Frühjahrssitzung der Sektion 4 ab. In Dresden haben die Hotels weitgehend geschlossen, viele Kolleginnen und Kollegen haben Dienstreiseverbot. Auch für den Bibliothekartag schwindet die Hoffnung. Das letzte Mal, dass ein Bibliothekartag abgesagt werden musste, war 1940. Wir leben offensichtlich wie im Krieg, jedoch mit einem wichtigen Unterschied: Der allergrößte Teil der Bevölkerung wird überleben. Diese Gewissheit hatten unsere Großeltern und haben die Menschen in Syrien und anderswo nicht.

Dr. Klaus-Rainer Brintzinger
Ludwig-Maximilians-Universität München
Direktor der Universitätsbibliothek